Ergänzend zu taddeos Antwort sei eine Charakterisierung der Psalmtöne angefügt. Prinzipiell ist es in der Tat möglich, jeden Psalm auf jeden Ton zu singen. Es fragt sich nur, wie sinnvoll das ist. (Das Gotteslob greift da ein paar Mal ziemlich ins Klo, was allerdings auch an der unmöglichen Psalmübersetzung liegt - vom Kantorenbuch zum GL mal ganz zu schweigen...)
Es ist durchaus üblich, bestimmte Psalmen bestimmten Tonarten zuzuordnen.
Der Codex Albi (vor 1079 geschrieben) beschreibt die vier Tonräume (jeweils den authentischen und plagalen Ausdruck eines Modus) wie folgt:
- Protus → "dramate" (spannungsgeladen)
- Deuterus → zeigt "miro numine" ("wunderbare Erhabenheit")
- Tritus → "micat" ("tut sich hervor")
- Tetrardus → "orans" und "adlapam" (erhellend, erheiternd und betend)
Der bekannte Choralforscher Godehard Joppich beschreibt die Töne wie folgt (ich zitiere hier nach Nikolaus Nonn OSB):
 Protus authenticus
Protus authenticus - I. Modus
Charakterisierung:
schwebend, mit Sentiment zu singen, "intim", "traurig"
Modale Hinweise:
subtonal; einziger Modus, der in der Mediatio einen Halbton steigt
Beispielspsalmen:
Meist Klage- und Vertrauenslieder; Ps 11, Ps 51
 Protus plagalis
Protus plagalis - II. Modus
Charakterisierung:
ähnlich universell wie Tetrardus plagalis, "nicht heiter"
Modale Hinweise:
subsemitonal; Tenor und Finalis: Spannung der kleinen Terz; nach dem Halbton in der Terminatio: große Terz (= größtes Intervall in der Psalmodie!)
Beispielspsalmen:
Ps 14, Ps 52, Ps 84
 Deuterus authenticus
Deuterus authenticus - III. Modus
Charakterisierung:
innere Erregung (Sehnsucht nach Gott), "unerfüllt", "sehsüchtig"
Modale Hinweise:
subtonal, Halbtonspannung
Beispielpsalmen:
Ps 40, Ps 75
 Deuterus plagalis
Deuterus plagalis - IV. Modus
Charakterisierung:
der "andere Ton", "ruhig" (Spannung des Textes)
Modale Hinweise:
subtonal; im Abstieg: zwei Terzen; Kadenzen durch Ganztöne (Quint abwärts)
Beispielpsalmen:
meist Klage- und Vertrauenslieder; Ps 129, Ps 142
 Tritus authenticus
Tritus authenticus - V. Modus
Charakterisierung:
spannungsvoller als einakzentige Formeln; "literarisch" (Zionspsalmen, Jerusalem)
Modale Hinweise:
subsemitonal; größtes Intervall: Quint im Anstieg
Beispielpsalmen:
meist Klage- und Vertrauenslieder; Ps 87, Ps 148
 Tritus plagalis
Tritus plagalis - VI. Modus
Charakterisierung:
"rekonzilianter" Ton, "beruhigt", "befriedet"
Modale Hinweise:
subtonal, berührt dreimal die Finalis, d.h. den Ruhepol: große Terz
Beispielpsalmen:
Ps 61, Ps 126, Ps 128, Ps 146
 Tetrardus authenticus
Tetrardus authenticus - VII. Modus
Charakterisierung:
"solider Ton", "große Geste", "extrovertiert"
Modale Hinweise:
subtonal, Ganztöne
Beispielpsalmen:
Ps 100, Ps 103, Ps 113
 Tetrardus plagalis
Tetrardus plagalis - VIII. Modus
Charakterisierung:
universellster Modus; "liebenswürdig", "heiter"
Modale Hinweise:
subsemitonal(e Spannung in der Meditatio)
Beispielpsalmen:
Ps 5, Ps 27, Ps 66
Der Tonus peregrinus wird bei Joppich nicht weiter charakterisiert, da er einzig zu Ps 114, einem Jahwe-Hymnus, passt. Neben den genannten Tönen gibt es eine Reihe älterer Modi, die im Psalterium Monasticum wieder eingeführt wurden. Darauf will ich jetzt nicht eingehen.
Auf die Gefahr hin, mich hier im Forum immer wieder selbst zu zitieren (

): die momentan beste Psalmübersetzung im deutschen Sprachraum ist die Münsterschwarzacher, wie man sie z.B. im Benediktinischen Antiphonale findet. Sprachlich und rhythmisch äußerst gelungen. Da war der Heilige Geist im Spiel!
 Erster Ton: Tonus Sollemnis
Erster Ton: Tonus Sollemnis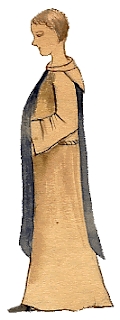 Zweiter Ton: Tonus Gravis
Zweiter Ton: Tonus Gravis Dritter Ton: Tonus Immensus
Dritter Ton: Tonus Immensus Vierter Ton: Tonus Mysticus
Vierter Ton: Tonus Mysticus Fünfter Ton: Tonus Laetus
Fünfter Ton: Tonus Laetus Sechster Ton: Tonus Serenus
Sechster Ton: Tonus Serenus Siebenter Ton: Tonus Sonorus
Siebenter Ton: Tonus Sonorus Achter Ton: Tonus Lucidus
Achter Ton: Tonus Lucidus