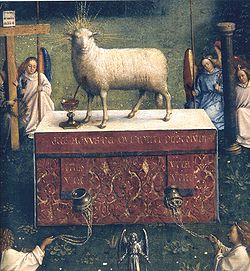Vollgottesdienst ist der Arbeitstitel bei den Verlautbarungen.
Jeder weiß dann was das ist.
St. Pölten als Nachweis
AKH Wien als Nachweis
Wenn der Diakon ordiniert ist, ist das in Ordnung. Das gibt es bei uns auch. Es war zwar in der Urkirche nicht üblich, dass Diakone eigenständig Gottesdienste feierten, aber das ist ein anderes Thema.Klostermops hat geschrieben:Gehen Sie in die Schweiz oder nach Österreich. Ständige Diakon feiern Vollgottesdienste und niemand nimmt Anstoß.
Naja, die SELK interpretiert etwas mehr hinein, aber im Endeffekt ist es dasselbe wie bei der VELKD. Die Ordination erfolgt durch die Kirche (nicht durch die Gemeinde), die von bereits ordinierten Geistlichen repräsentiert wird. Damit ist auch eine Kette der Handauflegungen gegeben (was bei der LCMS zumindest im 19. Jahrhundert scheinbar nicht mehr der Fall gewesen war, deshalb die Streitigkeiten mit den Missionaren der bayerischen Landeskirche).Bischof hat geschrieben:Das, was ich bisher gelesen habe, scheint mir so eine Art zwischending zwischen römisch-katholisch und VELKD zu sein.
Soweit ich weiss, ist das nicht so, da es sich nicht um Priesterweihen handelt, sondern um evangelische Ordinationen. Solange nicht klar ist, dass man Priester weihen will, hilft auch die Anwesenheit eines Bischofs in der Sukzession nicht viel...Lutheraner hat geschrieben: Übrigens nehmen an den landeskirchlichen Ordinationen mittlerweile öfters skandinavische Bischöfe teil. Diese Pfarrer sind also vermutlich auch für unsere anglikanischen Freunde gültig geweiht
Siehe vorigen Beitrag. Aus unserer Sicht nicht, da es sich um eine "Amtseinfuehrung" handelt, und nicht um eine "Weihe". Solange dieser Unterschied besteht, kann man nicht von einer Uebertragung der Sukzession sprechen.Bischof hat geschrieben:Hallo!
Ich habe eine Frage...
Bei der Amtseinführung von Bischof Hans-Jörg Voigt war auch der Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands anwesend, sowie je ein Bischof aus Polen und aus Tschechien. Die sog. apostolische Sukkzession, die ja für manch einem doch sehr wichtig zu scheint, hat doch die lettische lutherische Kirche erhalten, gelle (o.k. die Katholiken erkennen die nicht an) Da Erzbischof Vanags bei der Amtseinführung mitgewirkt (Handauflegung) hat die SELK deshalb jetzt die apostolische Sukkzession?
Herzliche Grüße
Bischof
Die apostolische Sukzession ist keine mechanische Abfolge von Ordinationen, die man auf irgendwelchen Pfaden bis hin zu den Aposteln verfolgen kann. Die apostolische Sukzession ist die Weitergabe des unverfälschten Geistes der apostolischen Tradition der Einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Das funktioniert also nicht wie bei Harry Potter. Es ist keine Magie, die durch Handauflegen weitergereicht wird. Die Kirche hat die Apostolische Sukzession, weil sie in der Wahrheit und damit in der Fülle der Gnade steht.Bischof hat geschrieben:...hat die SELK deshalb jetzt die apostolische Sukkzession?
Genau das sagte ich ja. Bzw. daß die apostolische Sukzession eine Nachfolge ist, die nicht einfach nur durch aufgelegte Hände bewerkstelligt wird. Deswegen ist die dort zitierte Frage von "Bischof" unsinnig.Mellon hat geschrieben:Daß jemand also in der Amtsnachfolge der Apostel steht, nützt nichts, wenn er nicht gleichzeitig auch „beständig in der der Lehre der Apostel bleibt“ (Apg 2,42).
Das alte Kreuz mit den Äbten. Über die Frage wurde in der Tat viel diskutiert und die Lösung bestand wohl darin, das Problem möglichst unter den Teppich zu kehren und zu hoffen, daß sich irgendwann niemand mehr dafür interessiert.Marcus hat geschrieben:Darum könnte man zumindest mal die Frage diskutieren, ob ein Priester im Notfall einen anderen zum Priester oder Diakon weihen kann?
So unsinnig ist die Frage gar nicht ...Nietenolaf hat geschrieben:Genau das sagte ich ja. Bzw. daß die apostolische Sukzession eine Nachfolge ist, die nicht einfach nur durch aufgelegte Hände bewerkstelligt wird. Deswegen ist die dort zitierte Frage von "Bischof" unsinnig.Mellon hat geschrieben:Daß jemand also in der Amtsnachfolge der Apostel steht, nützt nichts, wenn er nicht gleichzeitig auch „beständig in der der Lehre der Apostel bleibt“ (Apg 2,42).
Jeder lutherischer Pastor ist ein Bischof in der apostolischen Sukzession!
Jesus Christus war von Gott gesandt und bevollmächtigt, die Apostel wurde wiederum von Jesus Christus gesandt und bevollmächtigt, ebenso die Ältesten/Bischöfe als
Gemeindevorsteher von den Aposteln.
Eine hierarchische Unterscheidung zwischen Bischöfen und Ältesten schien der Bibel anfangs fremd zu sein. Titus und Timotheus wurden von Paulus später selbst bevollmächtigt, Bischöfe bzw. Älteste einzusetzen sowie Leitungs- und Visitationsaufgaben wahrzunehmen. Man kann das zwar als Indiz dafür ansehen, dass sich hier ein dem Ältestenamt (Presbyterat) übergeordnetes Bischofsamt herausbildete, ein sicherer Beweis ist dies allerdings nicht. Vielmehr zeigen diese Überlieferungen, dass sich in den Urgemeinden so langsam eine funktionelle Unterscheidung entstand. So gab es Bischöfe als Gemeindevorsteher, die man heute mit Pfarrern vergleichen könnte und Bischöfe als Regionalvorsteher (heute Pröpste) mit Disziplinargewalt und Visitationsaufgaben in ihrem Amtsbezirk. Selbst Ignatius von Antiochien, der schon Bischöfe, Presbyter und Diakone als eigenständige Ämter kennt, scheint mit dem Bischof den Gemeindevorsteher, also den Pfarrer zu meinen. Das Presbyterium könnte man selbst bei ihm eher als den Kirchenvorstand ansehen und die Diakone als Gehilfen des Gemeindevorstehers. Erst später lässt sich die Entwicklung feststellen, dass Bischöfe nur noch in (Haupt)-Städten residierten
und die zur Bischofskirchen gehörenden Gemeinden von Presbytern leiten ließen, die u.a. den Bischof bei der Eucharistiefeier vertraten. Der Presbyter wurde im Grunde
mit den selben Vollmachten wie der Bischof ausgestattet, allerdings mit der Einschränkung, dass er selbst keine Bischofs- und Priesterweihen vornehmen durfte. Hier stellt sich die Frage, ob so eine Einschränkung nicht nur kirchenrechtlicher Natur der Ordnung halber ist oder ob eine solche Einschränkung auch vor Gott verbindlich ist? Jesus Christus gebot Seinen Aposteln, das Evangelium allen Völkern zu verkünden, zu taufen, Abendmahl zu feiern und gab der Kirche bzw. den Aposteln als den Diener der Kirche Christie die Vollmacht, Sünden zu vergeben und zu
behalten. Er hat also letztlich EIN Amt gestiftet. Die Apostel setzten wiederum Bischöfe/Älteste als Gemeindevorsteher ein und gaben ihnen entsprechende Vollmachten. Nicht umsonst werden Bischöfe in ihrer Eigenschaft als Gemeindevorsteher in der Schrift als „Haushalter Gottes“ bezeichnet. Clemens von Rom schreibt sogar ausdrücklich, dass die Bischöfe bzw. Ältesten die Nachfolger der Apostel seien. Das kirchliches Amt wurde immer durch die Handauflegung weitergeben.
Bei Timotheus´ Ordination wirkten neben Paulus noch andere Presbyter mit. Wenn Bischöfe als Gemeindevorsteher später Presbyter einsetzten, die letztlich in den Urgemeinden das selbe Amt wie die Bischöfe gehabt und auch bei Ordinationen mitgewirkt hatten, sie damit beauftragten, zu predigen und die Sakramente zu verwalten, stellt dies eine ordentliche Einsetzung in das eine ordentliche Amt der Kirche in apostolischer Nachfolge dar. Verbietet man ihnen, andere Christen in das Amt einzusetzen, so sind sie wegen der Gemeindeordnung, die sie zu beachten haben,
gehalten, das nicht zu tun, eine von ihnen durchgeführte Ordination wäre aber nicht ungültig, sondern nur unerlaubt. Martin Luther und andere Reformatoren waren stets geweihte Priester und ordentlich damit beauftragt worden, zu predigen und die
Sakramente zu verwalten. Die Weihevollmacht, die sie nicht hatten, war auch bei ihnen rein kirchenrechtlicher Natur. Geht man nämlich nach dem NT, so hatten sie alle Vollmachten der damaligen Gemeindevorsteher. Nachdem Luther und andere aus der
römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen worden waren, aber ihr Vorhaben, die alte katholische Kirche in ihren Reihen zu reorganisieren, durchsetzen wollte und auch mussten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als bewährte Männer ins Predigeramt einzusetzen und sie mit der Leitung einer Pfarrgemeinde oder einer bestimmten Region zu beauftragen. Da sie keine römischen Katholiken mehr waren und daher auch nicht mehr an das kirchliches Recht gebunden waren, sind sogar die von ihnen vorgenommenen
Ordinationen nicht nur gültig, sondern auch erlaubt. Schließlich war jeder Gemeindevorsteher in der frühen Kirchengeschichte auch ein Bischof bzw. Episcopus/Aufseher. Lediglich der Unterscheidung wegen, wurden auch in den Gemeinden der Augsburger Konfession unterschiedliche Amtsbezeichnungen eingeführt. Der
Gemeindebischof wurde zum Pfarrer bzw. Pastor, der Bezirksbischof zum Superintendent, der Regionalbischof zum Propst und der Landesbischof zum Bischof.
Eine Sukzession als Handauflegungskette, die bis zum Apostolat zurückreicht, gibt es also sehr wohl auch in den lutherischen Kirchen.
@ SDStephen Dedalus hat geschrieben:Siehe vorigen Beitrag. Aus unserer Sicht nicht, da es sich um eine "Amtseinfuehrung" handelt, und nicht um eine "Weihe". Solange dieser Unterschied besteht, kann man nicht von einer Uebertragung der Sukzession sprechen.Bischof hat geschrieben:Hallo!
Ich habe eine Frage...
Bei der Amtseinführung von Bischof Hans-Jörg Voigt war auch der Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands anwesend, sowie je ein Bischof aus Polen und aus Tschechien. Die sog. apostolische Sukkzession, die ja für manch einem doch sehr wichtig zu scheint, hat doch die lettische lutherische Kirche erhalten, gelle (o.k. die Katholiken erkennen die nicht an) Da Erzbischof Vanags bei der Amtseinführung mitgewirkt (Handauflegung) hat die SELK deshalb jetzt die apostolische Sukkzession?
Herzliche Grüße
Bischof
Gruss
SD
Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Das war nicht zufällig ein Pfarrer der nordelbischen Landeskirche?monsieur moi hat geschrieben:Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Die Antwort macht mich bar erstaunt, wenn man bedenkt, dass auch hier an die Realpräsenz geglaubt wird. "Wenn wir es nicht aufbewahren können, dann wird es das nächste mal weiter benutzt, beim Brot, und den Wein müssen wir weggießen."
Das ist auch die wohl herrschende Meinung in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Das hat mir auch ein Student an der Luth. Hochschule in Oberursel bestätigt, der zuvor extra noch seinen Professor gefragt hatte.Pfr. Dr. Martens hat geschrieben:...Diese Realpräsenz fängt im übrigen auch nicht erst in dem Augenblick an, in dem der Kommunikant die gesegnete Hostie mit seinem Mund empfängt und aus dem Kelch trinkt; sie hängt wirklich einzig und allein an den Worten Christi selbst, die über den Elementen gesprochen werden. Entsprechend ist es angemessen, den Leib und das Blut Christi, die auf dem Altar gegenwärtig sind, auch schon vor dem Empfang anzubeten und am Ende der Sakramentsfeier darauf zu achten, daß die gesegneten Elemente, Leib und Blut Christi, sorgsam verzehrt werden und nicht etwa nach der Sakramentsfeier wieder mit ungesegneten Elementen vermischt oder gar weggeschüttet werden. Nicht vergessen werden darf dabei allerdings, daß die Einsetzung des Sakraments darauf zielt, daß Leib und Blut Christi auch wirklich von uns Christen gegessen und getrunken werden, wie Martin Luther dies in seiner Erklärung betont. Die Elemente werden nicht zur Anbetung, sondern zum Verzehr konsekriert
...
Daß wir im Sakrament Leib und Blut Christi empfangen, bedeutet im übrigen nicht, daß wir gleichsam jeweils nur ein „Stück“ von Christus erhalten würden: Es ist jedesmal der ganze Christus, den wir im gesegneten Brot und Wein empfangen; aber er kommt eben zu uns leibhaftig in der Gestalt seines Opfers am Kreuz: Leib und Blut, getrennt im Tod. Es geht im Heiligen Abendmahl um viel mehr als bloß um eine verschwommene personale Gegenwart des Herrn, die sich nicht wesentlich von seiner Verheißung unterscheidet, daß er, Christus, stets dort sein will, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind (Matthäus 18,20). Nein, seine sakramentale Gegenwart hat eine ganz eigene Qualität. Wenn wir also auch in den Elementen jeweils den ganzen Christus leibhaftig empfangen, ist es uns dennoch nicht erlaubt, die Austeilung des Heiligen Mahls auf die eine Gestalt des Brotes zu verkürzen: Christus hat befohlen: „Trinkt alle daraus“; darum wird allen Kommunikanten bei der Sakramentsausteilung auch der Kelch gereicht. So erhalten die Kommunikanten im Sakrament Anteil am Leib und Blut Christi; sie berühren IHN mit ihren Lippen und kommen so nahe an IHN heran, wie sonst nirgends auf der Welt. Ja, ER lebt in ihnen, nimmt in ihnen Wohnung durch diese Gabe des Heiligen Mahls. Kann es etwas Größeres auf dieser Welt geben als diese leibhaftige Gemeinschaft mit IHM, dem auferstandenen Herrn.
Quelle: http://www.lutherisch.de/index.php?opti ... &Itemid=40
Solange die SELK die Lehre von der Ap. Sukzession der Bischöfe nicht annimmt, hilft auch die Intention des handauflegenden Bischofs nicht. Erst wenn beide Seiten hier eine bischöfliche Sukzession herstellen wollen und dies auch offen so bekennen (etwa in der Liturgie), wird dies aus unserer Sicht relevant.Marcus hat geschrieben:@ SD
Wie wäre der Sachverhalt aus anglikanischer Sicht aber zu beurteilen, wenn der lettische Erzbischof Bischof Voigt die Hände in der Absicht aufgelegt haben sollte, ihn zum Bischof der SELK gemäß dem Verständnis seiner eigenen Kirche zu weihen? (könnte ja so sein) Wäre es dann eine gültige Bischofsweihe, weil sie zumindest von einem in der apostolischen Sukzession stehenden Bischof nicht nur als Amtseinführung, sondern als Weihe vollzogen worden wäre?
Dafür gibt es oft einen speziellen Ausguß in der Kirche - in römisch-katholischen übrigens auch (dort werden auch alte Hostien der Erde übergeben, ewig sind die im Tabernakel ja auch nicht haltbar). Frag mal einen röm.-kath. Priester deines Vertrauens.monsieur moi hat geschrieben:Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Die Antwort macht mich bar erstaunt, wenn man bedenkt, dass auch hier an die Realpräsenz geglaubt wird. "Wenn wir es nicht aufbewahren können, dann wird es das nächste mal weiter benutzt, beim Brot, und den Wein müssen wir weggießen."
Kenn ich. Unser Pater hält uns nach dem Messdienen immer an, uns darüber die Hände zu waschen, damit nichts verloren geht.Lutheraner hat geschrieben:Dafür gibt es oft einen speziellen Ausguß in der Kirche - in römisch-katholischen übrigens auch (dort werden auch alte Hostien der Erde übergeben, ewig sind die im Tabernakel ja auch nicht haltbar). Frag mal einen röm.-kath. Priester deines Vertrauens.monsieur moi hat geschrieben:Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Die Antwort macht mich bar erstaunt, wenn man bedenkt, dass auch hier an die Realpräsenz geglaubt wird. "Wenn wir es nicht aufbewahren können, dann wird es das nächste mal weiter benutzt, beim Brot, und den Wein müssen wir weggießen."
Aus diesen Gründen halte ich es für sehr durchdacht, dass sich bei uns die Kommunikanten in einer Liste eintragen müssen, wenn sie kommunizieren wollen. Da kann der Pfarrer die Menge der Hostien und des Weines abschätzen und es bleiben nur wenige Reste übrig, die dann vom Pfarrer beim "Lobgesang des Simeon" nach der Kommunion restlos verzehrt werden.monsieur moi hat geschrieben:Kenn ich. Unser Pater hält uns nach dem Messdienen immer an, uns darüber die Hände zu waschen, damit nichts verloren geht.Lutheraner hat geschrieben:Dafür gibt es oft einen speziellen Ausguß in der Kirche - in römisch-katholischen übrigens auch (dort werden auch alte Hostien der Erde übergeben, ewig sind die im Tabernakel ja auch nicht haltbar). Frag mal einen röm.-kath. Priester deines Vertrauens.monsieur moi hat geschrieben:Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Die Antwort macht mich bar erstaunt, wenn man bedenkt, dass auch hier an die Realpräsenz geglaubt wird. "Wenn wir es nicht aufbewahren können, dann wird es das nächste mal weiter benutzt, beim Brot, und den Wein müssen wir weggießen."
Der Pastor mit dem ich gesprochen hatte, hat in seiner Kirche keinen solchen Abfluss, das weiß ich daher, dass das früher meine Gemeinde war, bevor ich katholisch geworden bin und einmal dort in der Sakristei gewesen bin. So hatte der Pastor dann konkret von "Küchenabfluss" gesprochen.
Nein, Nordelbisch ist es nicht. Oldenburger Landeskirche. Direkt Landeskirchenhauptstadt....
Meiner Erfahrung nach wird, wenn kein spezieller Ausguß vorhanden ist, restlicher Wein, der nicht aufbewahrt und nicht ausgetrunken werden kann, in würdiger Form und unter Gebeten im Kirchhof oder dem Friedhof in die Erde geschüttet. Wenn der Rationalismus wuchert, dann tut's wohl auch der Küchenabfluß.monsieur moi hat geschrieben:Kenn ich. Unser Pater hält uns nach dem Messdienen immer an, uns darüber die Hände zu waschen, damit nichts verloren geht.Lutheraner hat geschrieben:Dafür gibt es oft einen speziellen Ausguß in der Kirche - in römisch-katholischen übrigens auch (dort werden auch alte Hostien der Erde übergeben, ewig sind die im Tabernakel ja auch nicht haltbar). Frag mal einen röm.-kath. Priester deines Vertrauens.monsieur moi hat geschrieben:Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Die Antwort macht mich bar erstaunt, wenn man bedenkt, dass auch hier an die Realpräsenz geglaubt wird. "Wenn wir es nicht aufbewahren können, dann wird es das nächste mal weiter benutzt, beim Brot, und den Wein müssen wir weggießen."
Der Pastor mit dem ich gesprochen hatte, hat in seiner Kirche keinen solchen Abfluss, das weiß ich daher, dass das früher meine Gemeinde war, bevor ich katholisch geworden bin und einmal dort in der Sakristei gewesen bin. So hatte der Pastor dann konkret von "Küchenabfluss" gesprochen.
Oder wie bei uns Katholischen, wo sich jeder, der zur Kommunion gehen will eine Hostie in die Schale legen kann.Marcus hat geschrieben:Aus diesen Gründen halte ich es für sehr durchdacht, dass sich bei uns die Kommunikanten in einer Liste eintragen müssen, wenn sie kommunizieren wollen. Da kann der Pfarrer die Menge der Hostien und des Weines abschätzen und es bleiben nur wenige Reste übrig, die dann vom Pfarrer beim "Lobgesang des Simeon" nach der Kommunion restlos verzehrt werden.monsieur moi hat geschrieben:Kenn ich. Unser Pater hält uns nach dem Messdienen immer an, uns darüber die Hände zu waschen, damit nichts verloren geht.Lutheraner hat geschrieben:Dafür gibt es oft einen speziellen Ausguß in der Kirche - in römisch-katholischen übrigens auch (dort werden auch alte Hostien der Erde übergeben, ewig sind die im Tabernakel ja auch nicht haltbar). Frag mal einen röm.-kath. Priester deines Vertrauens.monsieur moi hat geschrieben:Dabei muss ich wieder daran denken, wie ich einem evangelischen Pastor mal die Frage gestellt hatte, was mit dem Abendmal passiert, wo es in der Kirche ja keinen Tabernakel gibt.bei "Dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus Christus gebührt Anbetung." muesste man aber anmerken, dass es hierbei noch keine entsprechende praxis in der lutherischen tradition gibt. insofern ist die frage, was mit einem gemeinsamen "formulieren des gemeinsamen glaubens" gewonnen ist.
Die Antwort macht mich bar erstaunt, wenn man bedenkt, dass auch hier an die Realpräsenz geglaubt wird. "Wenn wir es nicht aufbewahren können, dann wird es das nächste mal weiter benutzt, beim Brot, und den Wein müssen wir weggießen."
Der Pastor mit dem ich gesprochen hatte, hat in seiner Kirche keinen solchen Abfluss, das weiß ich daher, dass das früher meine Gemeinde war, bevor ich katholisch geworden bin und einmal dort in der Sakristei gewesen bin. So hatte der Pastor dann konkret von "Küchenabfluss" gesprochen.
Nein, Nordelbisch ist es nicht. Oldenburger Landeskirche. Direkt Landeskirchenhauptstadt....