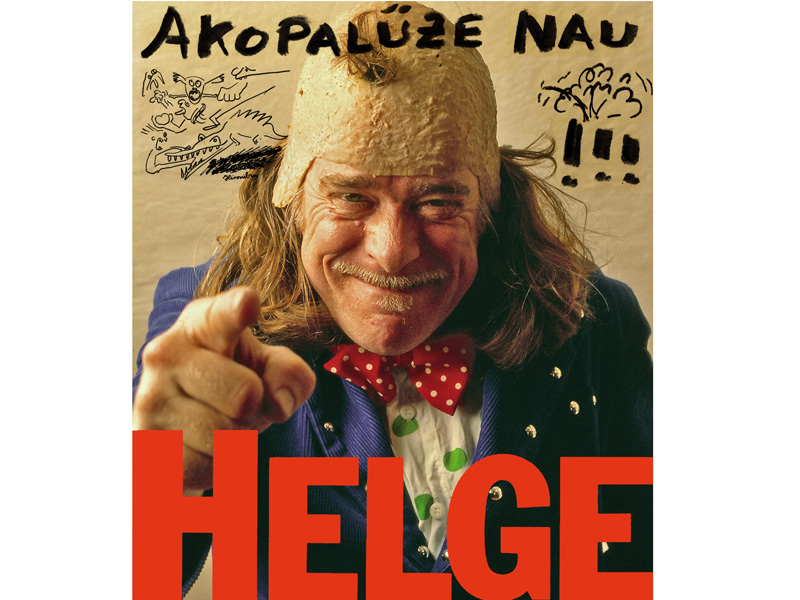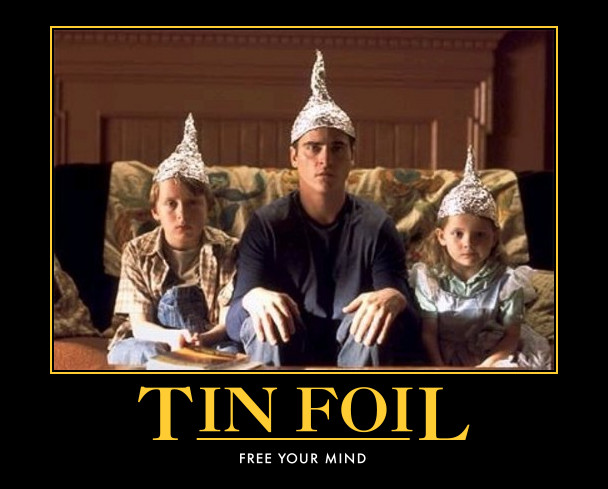Quasinix hat geschrieben:Das meinst Du aber nicht ernst, oder? Das klassische Bankgeheimnis gibt es doch wenn überhaupt nur noch in extrem abgespeckter Form, und der länderübergreifende Datenabgleich wird immer stärker ausgebaut. Sind SWIFT und das SWIFT-Abkommen (
1) ein Begriff? Oder wurde SEPA nur eingeführt, um die Merkfähigkeit für Zahlen zu trainieren?
Mir ist SWIFT ein Begriff, ich habe bereits vor zwei Jahren
hier darüber geschrieben.
Aber kennst Du das
Hawala-Banking? Auch Geldüberweisungen durch die amerikanischen Geldtransferbüro money graham oder Western Union oder anderen Geldtransfer-Büros können einfach "getürkt" werden: der echte Einzahler läßt den Vorgang gegen eine geringe Gebühr einen Strohmann mit dessen Papieren vornehmen.

Immer stärkerer Datenaustausch?
Bisher funktioniert der - halbwegs - mit den EU-Ländern und demnächst([Punkt]) mit der Schweiz und den USA. Die beiden letzteren Abkommen werden noch verhandelt (Schweiz) bzw. sind über FACTA bereits unterzeichnet, aber noch nicht gesetzesmäßig umgesetzt.
Die "Ausbeute" bezeichne ich als nicht gerade umfangreich. Ein flächendeckender automatischer(!) Datenaustausch mit der Mehrzahl der Länder dürfte wohl sehr, sehr lange auf sich warten lassen - sofern es ihn überhaupt jemals geben wird.
Quasinix hat geschrieben:
Und "
sich diesem Kontrollwunsch durch ein Konto im Ausland entziehen" einerseits und "
dieses über das Internet zu führen" andererseits in
einen Satz zu packen ist doch nicht ernstgemeint, oder? Achso, die Kommunikation beim Onlinebanking ist per SSL verschlüsselt? Das macht sie inkl. der Rahmenbedingungen so sicher wie ein Kind unsichtbar für andere wird, wenn es die Augen schließt

Nur wenn die Kontoführung vom "home-computer" aus erfolgt ist eine Identifizierung einwandfrei möglich. Nutzt man dafür ein Internet-Cafe oder das eigene smart-phone mit einer erworbenen, gebrauchten SIM-Karte, ist eine Nachverfolgung erheblich schwieriger, evtl. sogar unmöglich.
Quasinix hat geschrieben:
Den Verweis auf "Tochtergesellschaften internationaler Banken in den großen Finanzzentren" halte ich für den Versuch, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben.
D. konnte auch die deutschen (Landes-)Banken nicht zwingen, Auskünfte über das Vermögen deutscher Kunden zu geben, das bei den Tochtergesellschaften in Luxemburg oder der Schweiz gehalten wird/wurde. Tochtergesellschaften unterliegen dem Recht des Sitzstaates, sie sind keine exterritoriale Niederlassung der Muttergesellschaft.
Menschen haben und werden immer versuchen, staatliche Reglementierungen zu umgehen und häufig sind sie dabei erfolgreich.
Man kann es - weil dies mit dem Strangthema in Zusammenhang steht - bei der Geldwäsche sehen. Die USA haben 1986 den Kampf gegen die Geldwäsche ausgerufen, weil man glaubte, damit Drogenhandel, Mafia, Korruption usw. "in den Griff" zu kriegen. Ist das gelungen?

Ganz im Gegenteil, es wurden/werden verfeinerte Methoden entwickelt, die weitaus schwieriger nachzuweisen sind. Inzwischen ist die Geldwäsche nicht mehr bargeldfixiert, sondern es werden neue finanzielle Instrumente (z.B. Derivate) genutzt, die die bisherigen Transaktionskaskaden über Länder mit hohem Standard beim Bankgeheimnis (Schweiz, Singapur) und niedrig regulierten off-shore-Standorten überflüssig machen. Diese alten "Waschverfahren" sind nicht sicher, da sich die Spur des illegalen Geldes mit viel Aufwand zurückverfolgen läßt und die Gefahr der Entdeckung damit gegeben ist.
Auch aus rein empirischer Sicht scheint das aus der Welt der illegalen Drogen stammende bargeldfixierte Dreiphasenmodell nicht mehr zeitgemäss. Die Erträge im Drogenhandel fallen längst nicht mehr nur in Form von Bargeld an. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zwischenhändler, aber auch die Detailversorger der mittleren und oberen Kundensegmente der Kokain- und Heroinkonsumenten vermehrt auf Bezahlung mit Kreditkarten, Bank- oder Postüberweisungen drängen.
(,,,)
Der generelle Trend der Verlagerung der Geldwäscherei vom Bargeldbereich in den Achtzigerjahren in den Nichtbargeldbereich in den Neunzigerjahren, wird auch von den ökonometrischen Modellschätzungen des IWF-Oekonomen Peter Quirk bestätigt.
(...)
Wie jede marktgängige Technologie - ob legal oder illegal - unterliegt auch die Geldwäscherei einem ständigen Innovationsdruck. Zeitperidoden grundlegender Umwälzungen, wie im globalisierten Finanzgeschäft der Neunzigerjahre, verstärken diesen Druck. Die Umwälzungen auf den Finanzmärkten erfassten auch sämtliche für die Geldwäscherei relevanten Bereiche:
Finanzmärkte und Produkte ebenso sehr wie die Finanzinstitutionen und ihre Standorte.
In Kombination mit der verstärkten Geldwaschbekämpfung haben diese Umwälzungen neue Geldwäschereitechniken entstehen lassen. Zum Beispiel die Geldwäscherei mit Derivaten, welche die illegale Herkunft von schmutzigem Bargeld nicht in drei Schritten tarnt, sondern schmutziges Buchgeld mit einer einzigen chirurgisch gezielten Derivattransaktion in einen rechtlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich einwandfreien legitimierten Finanzwert verwandelt.
(...)
Geldwäscherei mit Derivaten ist der gesteuerte Durchlauf des schmutzigen Geldes durch einen solchen Derivatkontrakt, sodass die Kontraktpartei mit dem schmutzigen Geld verliert. Aufgrund des Nullsummenspiel-Charakters der Derivate taucht dieses Geld bei der anderen Kontraktpartei als legitimer Gewinn im Derivatgeschäft wieder auf. Die andere Kontraktpartei kann entweder die Partei mit dem Geldwaschbedürfnis selber sein, dann hat sie mit sich selbst gehandelt. Oder aber die andere Kontraktpartei ist ein Strohmann, der das saubere Geld später wieder zurückschiebt.
(Hervorhebung von mir)
http://www.wolfgang-hafner.ch/media/Gel ... ivaten.pdf
Ein Artikel der FAZ über die Geldwäsche chinesischer Beamter mit Hilfe von "Wetter-Derivaten"
hier.
Für die Geldwäsche verliert also die Bargeldkontrolle an Bedeutung. Es wird wahrscheinlich noch etwas dauern, bis die Regierungen bereit sind, daraus Folgerungen zu ziehen.
Ich habe auch erhebliche Zweifel, ob die neuen erheblichen technischen Möglichkeiten überhaupt zur flächendeckenden Überwachung eingesetzt werden können. Technisch wird das sicherlich möglich sein und auch entsprechende Filtersysteme könnten die Anzahl der verdächtigen Fälle reduzieren. Trotzdem bliebe noch immer eine Vielzahl von Fällen im Netz, die dann personell bearbeitet werden müßten. Dafür fehlt es an geschultem Personal und ob die dann u.U. arbeitslosen ALDI-Verkäuferinnen oder Schlecker-Frauen entsprechend umgeschult werden könnten, ist zumindest zu hinterfragen.
Man kann sich natürlich ein Szenario zurechtmalen, das irgendwo zwischen DDR 2. und Nord-Korea liegt - aber wie wahrscheinlich ist das?