Wikipedia hat geschrieben:Julius von Durostorum (auch Julius der Veteran; * um 255; † 27. Mai 304 in Durostorum (heute Silistra) in Bulgarien) ist ein Märtyrer der katholischen und orthodoxen Kirche. [...]
Julius diente 27 Jahre, wahrscheinlich in der Legio XI Claudia, der römischen Armee und nahm an etlichen Feldzügen teil. Er konvertierte zum Christentum. Kaiser Diokletian erließ 303 ein Edikt, das bei Todesstrafe Opfer an die Staatsgötter forderte und zu schweren Christenverfolgungen im Römischen Reich führte. Julius wurde denunziert, verhaftet und in Durostorum vor Gericht gestellt. Der Praefect Maximus wollte Milde walten lassen und forderte Julius mehrfach auf, das Opfer darzubringen. Aus Furcht vor „ewiger Verdammnis“ weigerte sich Julius und wurde schließlich zum Tode durch Enthaupten verurteilt. Auf dem Weg zum Richtplatz ermutigte ihn sein ebenfalls gefangener Kamerad Hesychius, der wenige Tage später gleichfalls hingerichtet wurde.
Heilige des Tages [1]
Re: Heilige des Tages
27. Mai: Hl. Julius von Durostorum, Märtyrer
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
28. Mai: Hl. Germanus von Paris, Bischof, Abt
Wikipedia hat geschrieben:Germanus von Paris, französisch Saint Germain, (* 496 bei Autun; † 28. Mai 576 in Paris) war in den Jahren von 550 bis 576 der 20. Bischof von Paris.
Germanus lebte als junger Erwachsener in Autun als Einsiedler, bevor er 530 zum Priester geweiht wurde. Zehn Jahre später wurde er Abt von St. Symphorien in Autun, wieder zehn Jahre später, 550, Bischof von Paris und Erzkaplan des Frankenkönigs Childebert I.. Er war ein beliebter Prediger, dessen Einsatz insbesondere den Gefangenen galt.
Heute ist Germanus vor allem aufgrund einer Kirchen- und Klostergründung bekannt, die er außerhalb von Paris (des prés bedeutet auf den Feldern) vornahm. Die Kirche St. Vincent sollte die Reliquien des heiligen Vinzenz aufnehmen, das Kloster wurde den Benediktinern gegeben. Germanus wurde in dieser Kirche beigesetzt, die nach ihm später ihren heutigen Namen erhielt: St. Germain-des-Prés. [...]
Germanus von Paris ist Patron der Gefangenen und der Musik. Er wird angerufen gegen Feuergefahr und Fieber.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
28. Mai: Hl. Lanfranc von Canterbury, Erzbischof, Abt

Wikipedia hat geschrieben:Lanfrank von Bec (* um 1010 in Pavia; † 28. Mai 1089 in Canterbury) war Theologe, Prior der Abtei Le Bec und Erzbischof von Canterbury.
Lanfrank stammte aus einer vornehmen Familie in Pavia und studierte an verschiedenen oberitalienischen Schulen die freien Künste. Ab etwa 1030 wirkte er als Lehrer der Grammatik, Logik und Rhetorik (Trivium) in Burgund, im Loiretal und an der Kathedralschule von Avranches.
Nach einem Bekehrungserlebnis trat er 1042 in die Einsiedlergemeinschaft der Abtei Le Bec ein, deren Prior er von 1045 bis 1063 war. Zu seinen zahlreichen Schülern zählten Gilbert Crispin und - ab 1059 - Anselm von Canterbury.
Im Abendmahlsstreit setzte er sich ab ca. 1050 vor allem gegen Berengar für die Auffassung der Realpräsenz ein und schuf mit seinem Rückgriff auf Aristoteles’ Lehre von Substanz und Akzidenz (de corpore et sanguine domini, Kap. 18) die Grundlage für die spätere Transsubstantiationslehre.
1063 wurde er Abt der Abtei St. Stephan in Caen und war unter Wilhelm von 1070 bis 1089 Erzbischof von Canterbury.

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
28. Mai: Hl. Wilhelm von Aquitanien, Laienbruder, Klostergründer

Wikipedia hat geschrieben:Wilhelm von Aquitanien (auch Wilhelm von Gellone, Wilhelm der Heilige, Guillaume de Gellone, Guillaume au Court Nez, Wilhelm Kurznase, Guilhem u.a.; * um 754; † 28. Mai 812 in Gellone, heute Saint-Guilhem-le-Désert bei Montpellier in Frankreich) aus dem nach ihm benannten Hause der Wilhelmiden war von 790 bis zum Jahr 806, als er sich in ein Kloster zurückzog, Graf von Toulouse.
Wilhelm war Sohn des Grafen Theodoricus von Autun und dessen Frau Aldana, die vielleicht eine Tochter des fränkischen Hausmeiers Karl Martell war, womit er ein Cousin von Kaiser Karl dem Großen gewesen wäre.
Karl der Große ernannte seinen Feldherrn Wilhelm 790 als Nachfolger des abgesetzten Grafen Choron zum Grafen von Toulouse. Aus seiner Aufgabe als Feldherr heraus führte er den Titel eines dux. 791 unterdrückte er einen Basken-Aufstand, 793 musste er bei einem Raubüberfall der Sarazenen am Fluss Aude eine Niederlage hinnehmen. 801 eroberte er gemeinsam mit Ludwig dem Frommen die Stadt Barcelona, übte danach für kurze Zeit die Herrschaft in Katalonien aus. Die „Vita Hludowici imperatoris“ Thegans berichtet zudem, dass ein Wilhelm im Jahr 801 bei Córdoba kämpfte, doch ist hier die Zuordnung zum Grafen von Toulouse unsicher.
Im Dezember 804 gründete Wilhelm die Abtei Gellone, die er mit Mönchen aus dem nahegelegenen Aniane besiedelte. Am 29. Juni 806 trat er selbst in das Kloster ein, jedoch nicht in führender Stellung, sondern blieb bis zu seinem Tod Einsiedler. Das Kloster trug anfangs den Namen St. Crucis nach einer Kreuzreliquie, die Karl der Große Wilhelm anlässlich seines Eintritts ins Kloster schenkte.
Wilhelm starb in Gellone und wurde hier auch bestattet. Sein Grab wurde zum Wallfahrtsort und Saint-Guilhem-le-Désert ist eine der Stationen auf der Via Tolosana, dem südlichsten der vier Jakobswege in Frankreich. Im Jahr 1066 wurde Wilhelm heiliggesprochen (er gilt als Schutzheiliger der Waffenschmiede), das Kloster wurde ab dem 12. Jahrhundert nach ihm Saint-Guilhem-le-Désert genannt. 1139 wurden die Reliquien Wilhelms transferiert, 1793, also während der Französischen Revolution zerstreut; die Überreste dieser Reliquien befinden sich heute in der Basilika St-Sernin de Toulouse.

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
29. Mai: Hl. Bona von Pisa, Terziarin

Wikipedia hat geschrieben:Bona von Pisa (lateinisch die Gute; * um 1156 in Pisa; † 29. Mai 1207/1208?) war eine katholische Augustinerterziarin und Mystikerin.
Auf einer Pilgerreise ins Heilige Land hatte sie die Erscheinung, Christus stecke ihr einen Ring an die Hand. Sie bewirkte in der Folge gemäß der Überlieferung viele Wunder, und man sprach ihr prophetische Fähigkeiten zu. Außer nach Palästina unternahm Bona von Pisa auch Pilgerfahrten nach Rom und nach Santiago de Compostela.
Ihre sterblichen Überreste werden in der Kirche San Martino in Pisa aufbewahrt.
Nach ihrer Heiligsprechung wurde sie zur Schutzpatronin der Stadt Pisa sowie der Pilger. 1962 ist sie von Papst Johannes XXIII. zur Patronin der Flugbegleiter ausgerufen worden. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
29. Mai: Hl. Maximin von Trier, Bischof
Wikipedia hat geschrieben:Der Heilige Maximin von Trier, auch Maximinus von Trier, (* Ende des 3. Jahrhunderts in Silly, Frankreich; † 12. September 346 in Poitiers, Frankreich) wurde 329 Bischof von Trier als Nachfolger des heiligen Agritius und war ein Gegner des Arianismus. Seinem Freund und Mitstreiter Athanasius gewährte er 335 bis 337 Asyl in Trier. Er starb 346 bei einer Reise von Konstantinopel nach Poitiers.
Maximinus war Bischof von Trier zur Zeit der Regierung der Söhne des Konstantin der Große.
Sein Nachfolger Paulinus überführte am 29. Mai 353 seine Gebeine nach Trier. An dieser Grabstätte wurde im 6. Jahrhundert eine Benediktinerabtei gegründet (später Reichsabtei St. Maximin). Die Johanneskirche wurde später in St. Maximin umbenannt.
Sein Haupt wird heute in der Pfarrkirche von Trier-Pfalzel verehrt.
Er gilt als Patron gegen Gefahren des Meeres, Regen und Meineid. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
29. Mai: Hl. Ursula Gräfin Ledóchowska, Ordensfrau, Ordensgründerin

Wikipedia hat geschrieben:Maria Ursula (Julia) Ledóchowska (* 17. April 1865 in Loosdorf, Niederösterreich; † 29. Mai 1939 in Rom) ist eine österreichisch-polnische Heilige.
Ihre Eltern, Anton Graf Ledóchowski und Josephine Gräfin Ledóchowski, geborene Gräfin Salis Zizers ließen sie auf den Namen Julia taufen. Ihre Schwester war die selige Maria Teresia Ledóchowska, ihr Bruder war der jesuitische Ordensgeneral Wladimir Ledóchowski, ihr Onkel Mieczysław Halka Ledóchowski war Erzbischof von Gnesen und Posen und später Kardinal und Präfekt der Kongregation zur Verbreitung des Glaubens in Rom. Im Alter von 18 Jahren übersiedelte Julia Ledóchowska mit ihrer Familie nach Lipnica in Polen (Diözese Tarnow).
1887 trat sie in das Kloster der Ursulinen in Krakau ein und nahm zur Einkleidung den Ordensnamen Ursula an. 1904 wurde sie zur Oberin des Klosters gewählt. 1907 wurde sie mit zwei Schwestern nach St. Petersburg zur Erhaltung des dortigen Katharinenpensionats und zur Unterstützung der polnischen Jugend gegen die russischen Bedrängungen entsandt. 1914 musste sie aber auf Grund des Ersten Weltkrieges das Land verlassen. Ihr Weg führte sie nach Stockholm.
In Skandinavien führte sie ihre Arbeit als Erzieherin fort. Sie gründete eine Mädchenschule und ein Waisenhaus für Kinder polnischer Emigranten. Außerdem arbeitete sie für das von dem Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz in der Schweiz gegründete Komitee zur Hilfe der Kriegsopfer und bemühte sich in Skandinavien die Menschen für die Frage der polnischen Unabhängigkeit zu sensibilisieren.
1920 kehrte sie mit 40 St. Petersburger Ursulinen nach Polen zurück und ließ sich in Pniewy bei Posen nieder. Wenig später gestattete ihnen Papst Benedikt XV. die Gründung einer eigenen Ordensgemeinschaft, der Ursulinen vom Herzen Jesu im Todeskampf. Wegen des grauen Habits werden sie auch Graue Ursulinen genannt. Die Grauen Ursulinen widmen sich vor allem der christlichen Erziehung und Armenfürsorge. Heute beträgt ihre Zahl über 1.100, und sie wirken auf fast allen Kontinenten.
Ihr Leichnam wurde 1989 von Rom nach Pniewy überführt. 1983 wurde Sr. Ursula von Papst Johannes Paul II. selig- und am 18. Mai 2003 heiliggesprochen.

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
30. Mai: Hl. Ferdinand III. von Léon und Kastilien

Wikipedia hat geschrieben:Ferdinand, genannt der Heilige (* 30. Juli oder 5. August 1199 in Zamora; † 30. Mai 1252 in Sevilla) war als Ferdinand II. König von Kastilien und ab 1230 als Ferdinand III. König von Kastilien und León.
Ferdinand wurde als Sohn des Königs Alfons IX. von León und Berenguela von Kastilien, Tochter Alfons' des Edlen von Kastilien, 1199 geboren. Er wurde nach dem Tod seines Onkels Heinrich I. 1217 König von Kastilien und nach dem Tod seines Vaters 1230 auch von León, das nun neben Asturien und Galicien mit Kastilien zu einem einigen, unteilbaren, auf den ältesten Sohn vererblichen Königreich vereinigt wurde. Hierdurch wurde der Grundstein zur Größe Kastiliens und zur Vernichtung der maurischen Macht in Spanien gelegt.
Ferdinand gewann nach mehreren Siegen über die Mauren, besonders bei Jerez de la Guadiana 1233, der Einnahme Córdobas 1236, der Eroberung von Jaén 1246, Sevilla 1248, Cádiz 1250 und anderen Städten, allmählich die Kontrolle über weite Teile der iberischen Halbinsel, die kastilische Herrschaft reichte bis an das südliche Meer heran.
Nur das Königreich Granada blieb den Mauren, aber unter kastilischer Oberherrschaft. Die Folge war eine massenhafte Auswanderung der Mauren aus den von den Christen eroberten Ländern; die Zurückbleibenden wurden auf harte Weise unterdrückt. Überhaupt war Ferdinand ein großer Feind jeder häretischen Meinung; er stiftete mehrere Bistümer, gründete den Dom von Toledo sowie die Universität Salamanca, erwarb sich um die Zivilgesetzgebung großes Verdienst durch den von seinem Sohn vollendeten Código de las Partidas und die romanische Übersetzung des für die Mauren von Córdoba geltenden Gesetzbuches und wurde für seine Verdienste um den katholischen Glauben 1671 von Papst Klemens X. kanonisiert. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
30. Mai: Hl. Johanna von Orléans, Märtyrerin

Wikipedia hat geschrieben:Jeanne d’Arc ([ʒanˈdaʁk]); (* 6. Januar 1412 in Domrémy, Lothringen; † 30. Mai 1431 in Rouen), im deutschsprachigen Raum auch Johanna von Orléans oder die Jungfrau von Orléans genannt, ist eine französische Nationalheldin und Heilige der katholischen und der anglikanischen Kirche.
Während des Hundertjährigen Krieges führte sie die Franzosen gegen die Engländer und die Burgunder. Durch Verrat wurde sie von den Burgundern gefangen genommen und an die mit ihnen verbündeten Engländer verkauft. Ein Kirchenprozess sollte sie diskreditieren. Unter dem Vorsitz des Bischofs von Beauvais, Pierre Cauchons, der den Engländern nahestand, wurde sie wegen einiger Verstöße gegen die Gesetze der Kirche verurteilt und auf Befehl des Herzogs von Bedford auf dem Marktplatz von Rouen auf einem Scheiterhaufen verbrannt. 24 Jahre später strengte die Kurie einen Revisionsprozess an, hob das Urteil im Jahre 1456 auf und erklärte sie zur Märtyrerin.
Im Jahre 1909 wurde sie von Papst Pius X. selig- und elf Jahre später 1920 von Papst Benedikt XV. heiliggesprochen. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
30. Mai: Hl. Reinhild von Westerkappeln, Märtyrerin
Wikipedia hat geschrieben:Reinhild von Westerkappeln ist eine Heilige und Märtyrin der römisch-katholischen Kirche. Der Legende nach lebte sie im 12. Jahrhundert in Westerkappeln, Kreis Steinfurt, und wurde von ihren Eltern ermordet. [...]
Das Leben der Reinhildis ist in einer Sage übermittelt, die im Tecklenburger Land sehr bekannt ist. In der Literatur beschrieben wird die Sage unter anderem von Friedrich Arnold Steinmann 1825 und von Johann Georg Theodor Grässe 1868.
Laut dieser Sage wurde sie im „Knüppenhaus“, einem Bauernhaus in Westerkappeln-Düte, geboren. Dort hatte sie unter ihrer hartherzigen Mutter und ihrem Stiefvater harte Arbeit zu verrichten.
Sie war seit frühester Kindheit sehr fromm und immer, wenn sie die Kirchenglocken hörte, eilte sie zum Gottesdienst. Die liegengebliebenen Arbeiten sollen Engel für sie verrichtet haben. So sollen, trotz ihrer Abwesenheit, die Pferde – von Engelshand geführt – mehr Furchen im Acker gezogen haben, als es ein Mensch vermag. Dadurch dass die Eltern sahen, dass Gott sich ihrer Tochter zuwendete, sollen ihre Herzen sich noch mehr verhärtet haben, und sie verboten ihr zum Gottesdienst zu gehen. Eines Tages soll ihre Mutter sie in einen Brunnen gestoßen haben, aber am nächsten Morgen saß sie wieder am Brunnenrand. Aus Wut erwürgte die Mutter Reinhild und begrub sie im Stall unter den Tieren. Zur gleichen Zeit soll ihr Stiefvater auf dem Rückweg von Osnabrück vom Pferd gefallen sein und sich sein Genick gebrochen haben.
Der Stall soll daraufhin von einem Licht umhüllt gewesen sein, sodass die Tat von den Nachbarn schnell entdeckt wurde. Reinhild wurde mit ihren Stiefvater in einem Grab beerdigt, doch befand sich laut der Sage der Leichnam jeden neuen Morgen wieder außerhalb des Grabes. Daraufhin wurde ihr Leichnam auf einen Ochsenkarren gelegt. Die Ochsen liefen dann frei ihres Weges. In Ibbenbüren angekommen, sollen die Kirchenglocken ohne Zutun von Menschenhand zu läuten angefangen haben. In Riesenbeck, wo sie begraben wurde, sollen die Ochsen in der Nähe des Grabes eine Quelle freigelegt haben. Diese Reinhildisquelle soll Heilwirkung gehabt haben. Im Grab selbst soll Reinhildis noch ganz unverwest sein. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
31. Mai: Hl. Baptista von Varano, Äbtissin, Klostergründerin

Wikipedia hat geschrieben:Camilla Battista Varano (* 9. April 1458 in Camerino, Marken, Italien; † 31. Mai 1524 daselbst) war eine italienische Klarissin und Mystikerin. [...]
Camilla Varano war eine Prinzessin, Tochter des Herzogs von Camerino und einstigen Generalkommandanten der Venezianer Giulio Cesare Varano. Sehr früh entwickelte sie eine tiefe Beziehung zum Leiden Jesu. Hiervon handeln auch ihre späteren Schriften, ohne den für die Hl. Margareta Maria Alacoque charakteristischen Sühnegedanken zu entfalten. Durch ihre Schriften, von denen viele noch unveröffentlicht sind, wurde sie eine Wegbereiterin der neuzeitlichen Herz-Jesu-Verehrung. Am 14. November 1481 trat Camilla Varano in das Klarissenkloster zu Urbino ein und erhielt den Ordensnamen Battista. Im Jahr 1484 übersiedelte sie in das von ihrem Vater gegründete neue Klarissenkloster Santa Chiara in ihrer Geburtsstadt Camerino und wurde dort 1499 zur Äbtissin gewählt.
Im Jahr 1502 wurden ihr Vater und ihre drei Brüder durch Cesare Borgia ermordet. 1505 gründete sie auf Wunsch von Papst Julius II. ein Kloster in Fermo, kehrte aber nach zwei Jahren nach Camerino zurück, wo sie bis zu ihrem Tod an der Pest Äbtissin blieb. Die Trauerfeiern fanden im herzoglichen Palast statt. Sr. Battista liegt in Chor von Santa Chiara in Camerino begraben. Papst Gregor XVI. sprach sie am 7. April 1843 selig. Die Heiligsprechung von Camilla Battista Varano durch Papst Benedikt XVI. fand am 17. Oktober 2010 statt. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
31. Mai: Hl. Felix von Nicosia, Ordensmann

Wikipedia hat geschrieben:Felix von Nicosia (it.: Felice da Nicosia), geboren als Giacomo Amoroso, (* 5. November 1715 in Nicosia, Sizilien; † 31. Mai 1787 ebenda) war ein italienischer Kapuzinermönch.
Giacomo, der zuvor Schuster war, trat 1743 den Kapuzinern unter dem Ordensnamen Felix bei und war innerhalb der Gemeinschaft als Bettelbruder tätig. Er war mystisch begabt und soll die Gaben der Wunder besessen haben. Er wurde 1888 von Papst Leo XIII. selig- und am 23. Oktober 2005 von Papst Benedikt XVI. heiliggesprochen. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
31. Mai: Hl. Petronilla, Märtyrerin

Wikipedia hat geschrieben:Petronilla (lateinisch: die Kleine aus dem Geschlecht der Petronier; im LCI Petrolina von Rom) war eine frühchristliche Märtyrin. Die heilige Petronilla erlitt das Martyrium im 2. oder 3. Jahrhundert. [...]

Exáudi nos, Deux, salutáris noster: ut, sicut beátæ Petroníllæ Vírginis tuæ festivitáte gaudémus; ita piæ devotiónis erudiámur afféctu.
Per Dominum.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
01. Juni: Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer
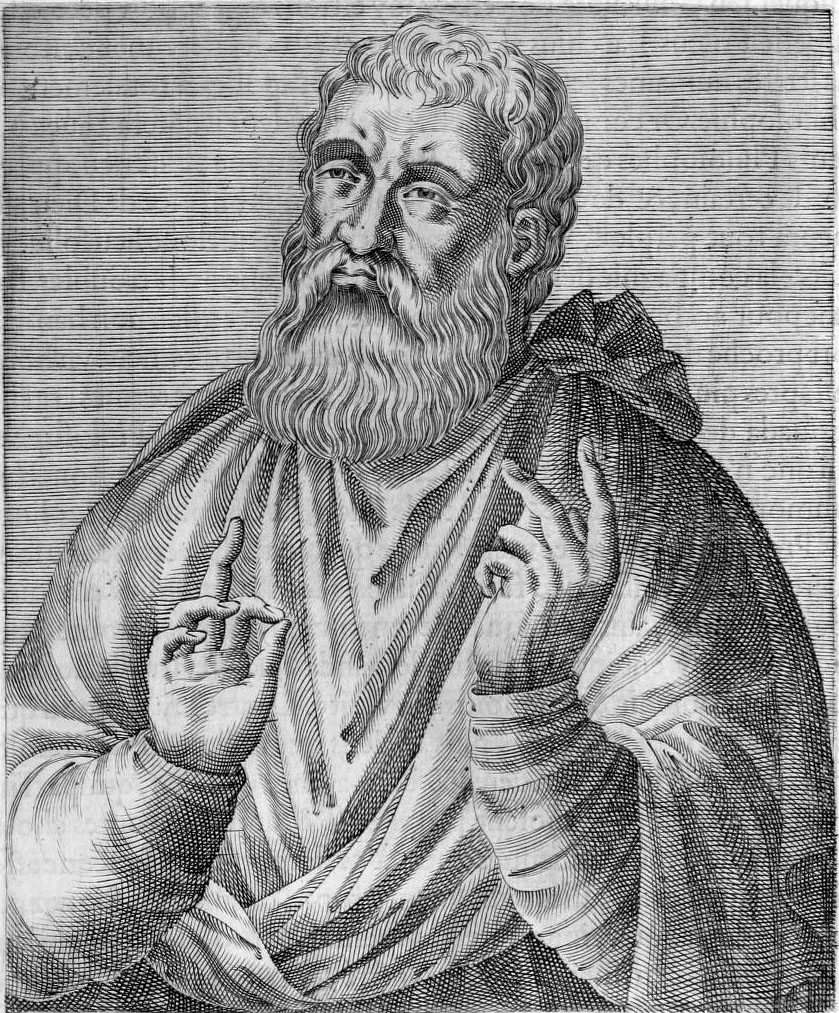
Wikipedia hat geschrieben:Justin (lat. Justinus, griech. Justinos), genannt »der Märtyrer«, auch genannt »der Philosoph« (* um 100; † 165 in Rom), war ein christlicher Märtyrer und Kirchenvater sowie Philosoph.
Justin war ein Kirchenlehrer des 2. Jahrhunderts, der unter die Apologeten eingereiht wird. Seine Auffassung ist vom Platonismus beeinflusst und gilt als Beginn der Adaption griechischer Philosophie im Christentum (wenn auch schon das auf dem logos-Gedanken gegründete Evangelium des Johannes in diese Richtung weist). Auf der Suche nach der Wahrheit hat er sich mit mehreren philosophischen Richtungen vertraut gemacht (Stoiker, Peripatetiker und Pythagoreer). Als Platoniker dachte er über die Gottesfrage nach und wurde auf die Propheten aufmerksam. So bekehrte er sich schließlich zum Christentum, der "allein zuverlässigen und brauchbaren Philosophie".
Justin, der als Sohn eines Priskos und Enkel eines Baccheios bezeichnet wird, wurde wahrscheinlich in Machusa (das nach der Zerstörung durch Vespasian dann Flavia Neapolis hieß) bei Sichem in Palästina geboren und wuchs in eher wohlhabenden Verhältnissen auf. In seiner Apologie stellte er sich als Justinos, Sohn des Priskos, Sohn des Bacheios, von Flavia Neapolis, in Syrien Galiläa vor. Er entstammte einer heidnischen Familie und beschäftigte sich schon früh mit Philosophie. In Nablus geht er nacheinander in die Schule eines Stoikers, eines Peripatetikers und schließlich eines Platonikers. Später wandte er sich, möglicherweise in Ephesus, dem Christentum zu, ließ sich in Rom nieder und gründete dort eine philosophische Schule. In Rom geriet er in Auseinandersetzungen mit dem kynischen Philosophen Crescentius und wurde von diesem oder einem seiner Anhänger wahrscheinlich wegen seiner Lehren angezeigt. Andere Quellen besagen, dass Justinus von einem seiner eigenen Schüler verraten worden wäre.
Justin wurde so während der Regierungszeit des Kaisers Marc Aurel mit sechs anderen Christen verhaftet, im folgenden Prozess zu deren Wortführer und schließlich verurteilt und hingerichtet. [...]
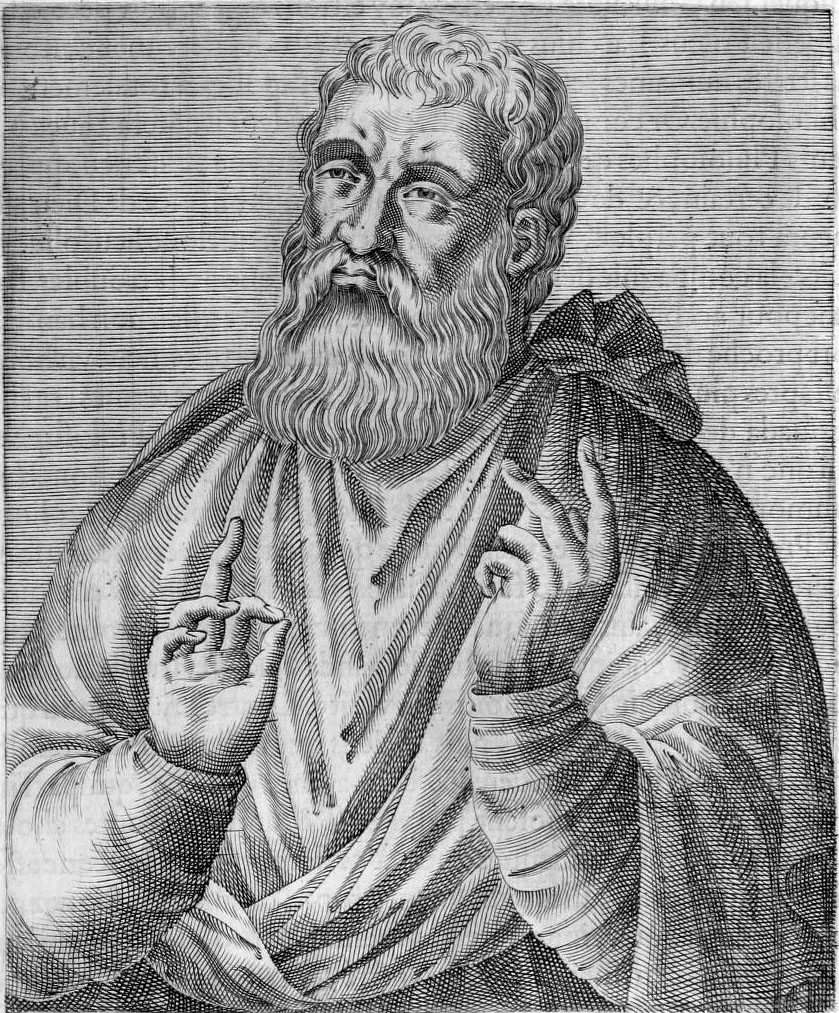
Gott, du hast den heiligen Märtyrer Justin in der Torheit des Kreuzes die erhabene Weisheit Jesu Christi erkennen lassen. Hilf uns auf seine Fürsprache, dass wir nicht falschen Lehren folgen, sondern im wahren Glauben feststehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Deus, qui per stultítiam Crucis eminéntem Iesu Christi sciéntiam beátum Iustínum Mártyrem mirabíliter docuísti: eius nobis intercessióne concéde; ut, errórum circumventióne depúlsa, fídei firmitátem consequámur.
Per Dominum.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
01. Juni: Hl. Hannibal Maria di Francia, Priester, Ordensgründer
Wikipedia hat geschrieben:Annibale Maria di Francia (* 5. Juli 1851 in Messina, Italien; † 1. Juli 1927 daselbst) war ein italienischer Priester, Ordensgründer und Heiliger.
Annibale, dessen Vater starb, als er wenig mehr als ein Jahr alt war, trat 7-jährig in das Kolleg der Zisterzienser ein und wurde 1878 zum Priester geweiht. Danach widmete er sich hingebungsvoll den Menschen im Armenviertel "Avignone" am Rande Messinas und rief 1882 ein Waisenhaus ins Leben. 1887 gründete er die "Kongregation des Herzens Jesu" und 1897 den Orden der "Rogationisten", der 1926 päpstlich anerkannt wurde. Heute sind beide Ordensgemeinschaften in der "Kongregation der Töchter des Herzens Jesu und der Rogationisten" vereint.
Annibale wurde von Papst Johannes Paul II. 1990 selig- und 2004 heiliggesprochen. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
01. Juni: Hl. Kuno I. von Trier, Bischof, Märtyrer
Wikipedia hat geschrieben:Kuno (Konrad) von Pfullingen, (* um 1016 in Pfullingen; † 1. Juni 1066 in Ürzig) wurde auf Betreiben Erzbischof Annos II. von Köln, seines Onkels, im Jahre 1066 zum Erzbischof von Trier ernannt. Die Trierer Bürger und Dienstmannen (Ministerialen) fühlten sich bei dieser Entscheidung übergangen und äußerten ihren Unmut in der Gefangennahme und Ermordung des Elekten.
Nachdem am 15. April 1066 Erzbischof (Ebf.) Eberhard von Trier gestorben war, schlug Ebf. Anno II. von Köln seinen Neffen Kuno für den frei gewordenen Erzstuhl vor. Kuno entstammte dem Geschlecht der Grafen von Pfullingen [Schwaben] und war damals Propst der Domkirche zu Köln. Da bei der Ernennung durch Kaiser Heinrich IV. die Bevölkerung, der Adel und der Klerus in Trier übergangen wurden, entstand in der Stadt großer Unmut und man rechnete mit Störungen bei der Einsetzung Kunos. So erhielt Bischof (Bf.) Einhard von Speyer den Auftrag, Kuno bewaffnetes Geleit zu geben.
Nördlich von Trier, bei Bitburg, schlugen Bf. Einhard und Ebf. Kuno am 17. Mai 1066 ihr Nachtlager auf. Am Morgen des 18. Mai 1066 überfielen Graf Theoderich (Vogt und zugleich Träger des burggräflichen Amtes Triers) und seine Männer das Lager, beraubten Einhard und nahmen Kuno gefangen. Kuno wurde sodann ostwärts auf die Burg Ürzig verschleppt und eingekerkert. Nach zwei Wochen Gefangenschaft erhielten vier Kriegleute am 1. Juni 1066 den Befehl, Kuno zu ermorden. Nachdem er drei Mal von einem Vorsprung nahe der Burg gestürzt worden war und immer noch lebte, wurde Kuno enthauptet. Sein Leichnam blieb für die nächsten 30 Tage unbestattet, bis Bauern des Dorfes Lösnich ihn fanden.
Nach einer vorläufigen Bestattung Kunos in Lösnich an der Mosel wurde sein Leichnam auf Betreiben Bischof Theoderichs von Verdun in die Klosterkirche der Benediktinerabtei Tholey überführt und dort am 10. Juli 1066 beigesetzt. Auf das Betreiben des damaligen Ebf. von Mainz, Siegfried, wurde Kuno I. kanonisiert und seine Mörder exkommuniziert.
Da Erzbischof Anno II. sich, vielleicht wegen seiner vielfältigen politischen Aktivitäten, weder beim Papst noch beim König großer Beliebtheit erfreute, blieb der Mord an Kuno für die Täter weitgehend folgenlos.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
01. Juni: Hl. Simeon von Trier, Diakon, Mönch, Einsiedler

Wikipedia hat geschrieben:Der heilige Simeon von Trier, (* um 980/990 in Syrakus auf Sizilien; † 1. Juni 1035 in Trier), war ein byzantinischer Mönch, der sein Leben als Eremit beschloss.
Simeon wurde als Sohn eines griechischen Offiziers im byzantinischen Syrakus geboren, wuchs in Konstantinopel auf und wurde dort ausgebildet. Er war sieben Jahre lang als Pilgerführer in Jerusalem und in Palästina tätig. Dann verbrachte er zwei Jahre als Mönch im Marienkloster in Bethlehem, später wechselte Simeon ins Katharinenkloster am Sinai, wo er sich auf das spätere Leben als Einsiedler vorbereiten wollte.
Von seinem Abt wurde er zum jährlichen Almosenempfang zu Herzog Richard II. der Normandie gesandt. Dabei wurde sein Schiff von Piraten angegriffen, aber er konnte sich ans Ufer retten. Trotzdem setzte er seinen Weg fort und schloss sich unterwegs 1026 den Äbten Richard von St. Vanne und Eberwin von St. Martin (Trier) an, die auf der Rückreise von Jerusalem waren.
Bei seiner Ankunft in Rouen (1027) war der Herzog Richard II. jedoch bereits verstorben. Eberwin von St. Martin stellte ihn im selben Jahr Erzbischof Poppo vor und man beschloss, dass Simeon den Trierer Erzbischof Poppo auf dessen Pilgerfahrt ins Heilige Land (1028 – 1030) begleiten sollte. Nach ihrer gemeinsamen Rückkehr ließ sich Simeon am Andreasfest 1030 feierlich in den östlichen Turm des mächtigen römischen Stadttores der Porta Nigra in Trier einmauern, um dort ganz zurückgezogen im Gebet als Eremit (Einsiedler) leben zu können. Nach dem Glauben in der Bevölkerung war er wundertätig.
Auf seinen Reisen legte er etwa 25.000 Kilometer zurück. Hilfreich war, dass er Griechisch, Ägyptisch, Arabisch, Syrisch, und Romanisch sprach.
Erzbischof Poppo und Eberwin von St. Martin bewirkten nach seinem Tod, dass er bereits im Dezember 1035 durch den Papst Benedikt IX. heilig gesprochen wurde. Damit war Simeon nach Ulrich von Augsburg der zweite Heilige, der offiziell kanonisiert wurde. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Marcellinus und hl. Petrus, Märtyrer in Rom

Wikipedia hat geschrieben:Der heilige Marcellinus (* in Rom; † 299 oder 304 in Rom) war ein frühchristlicher Priester, der in den Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian das Martyrium erlitt.
Marcellinus wurde um das Jahr 299 oder 304 während der Verfolgungen unter Kaiser Diokletian ins Gefängnis geworfen. Nach der Überlieferung nutzte Marcellinus zusammen mit dem Exorzisten Petrus die Haft, um Mitgefangene zum christlichen Glauben zu bekehren und heimlich zu taufen. Dies blieb dem Kerkerpersonal nicht verborgen. Marcellinus und Petrus wurden gefoltert und danach im „schwarzen Wald“ (Sylva nigra) bei Rom enthauptet.
Der Überlieferung zufolge wurden zwei fromme Frauen, Lucillia und Firmina, im Traum damit beauftragt, die Leichen der Hingerichteten zu bergen. Das Begräbnis fand 2. Juni statt. [...]
Wikipedia hat geschrieben:Der heilige Petrus Martyr (* in Rom; † 299 oder 304 in Rom) war ein frühchristlicher Exorzist, der unter Kaiser Diokletian wegen seines christlichen Glaubens hingerichtet und so zum Märtyrer der römisch-katholischen Kirche wurde.
Petrus wurde um das Jahr 299 oder 304 wie viele andere römische Frühchristen während der Verfolgungen unter Kaiser Diokletian in den Kerker geworfen. Christen hatten zu dieser Zeit die Möglichkeit, ihrem Glauben abzuschwören und so weiterer Strafe und Folter zu entgehen. Nach der Überlieferung nutzte Petrus zusammen mit dem Priester Marcellinus die Haft, um Mitgefangene zum christlichen Glauben zu bekehren und heimlich zu taufen. Die Aktivitäten blieben dem Kerkerpersonal nicht verborgen. Petrus und Marcellinus wurden gefoltert und danach im „schwarzen Wald“ (Sylva nigra) bei Rom enthauptet. [...]

Gott, du gibst deiner Kirche Kraft und Halt durch das mutige Glaubensbekenntnis der Heiligen. Hilf uns auf die Fürsprache der Märtyrer Marcellinus und Petrus, dass auch wir aus dem Glauben leben und dich standhaft bekennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Deus, qui nos ánnua beatórum Mártyrum tuórum Marcellíni, Petri atque Erásmi sollemnitáte lætíficas: præsta, quaesumus; ut, quorum gaudémus méritis, accendámur exémplis.
Per Dominum.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Adalgisus, Priester
Wikipedia hat geschrieben:Adalgisus, auch Algisus genannt, († um 670) war ein Priester, der in der Landschaft Thiérache in der heutigen Picardie lebte und wird als ein Heiliger der katholischen Kirche betrachtet. [...]
Adalgisus wurde in Irland als Sohn einer sowohl vornehmen als auch frommen Familie geboren. Er war entgegen einigen Überlieferungen nicht Mitglied einer königlichen Familie. Bereits früh begab er sich zu dem schottischen Bischof Furseus und wurde von diesem zum Priester geweiht. Von Schottland aus begab er sich in das heutige Frankreich und erhielt dort die königliche Erlaubnis im Wald von Tierache an der Stelle eine Klosterzelle zu errichten, an der Wasser hervorgequollen sein soll, als er einen Stab in den Boden stieß. In der Folge des bereits zu Lebzeiten ihn umgebenden Rufes der Heiligkeit zog er erhebliche Menschenmengen an. Adalgisius soll von einer Wallfahrt nach Rom soll er Reliquien mitgebracht haben. Etwa 670 verstarb er. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Erasmus (Elmo), Bischof, Märtyrer, Nothelfer

Wikipedia hat geschrieben:Erasmus (* um 240 in Antiochia; † 303 in Formia) war ein Bischof und ist ein heiliger Märtyrer der katholischen Kirche; er ist auch unter dem Namen Elmo bzw. Ermo bekannt.
[...] Er stammte aus Antiochien, wo er auch als Bischof wirkte, doch musste er seine Diözese während der Christenverfolgung unter Diokletian verlassen. Der Legende nach zog er sich auf einen Berg des Libanon zurück, wo er sieben Jahre lang auf wundersame Weise von einem Raben genährt wurde (s.a. Elija). Auf die Erscheinung eines Engels hin kehrte Erasmus in sein Bistum zurück, wo er bald darauf gefangengenommen wurde. Er soll verschiedene Folterungen, wie Ausdärmen, erlitten haben. Mit göttlichem Beistand jedoch soll er befreit worden und nach Italien gelangt sein, wo er hernach als Seelsorger in der Gegend von Formia wirkte. Dort soll er nach sieben Jahren in hohem Alter gestorben sein. [...] Seit etwa 1300 wird er zu den 14 Nothelfern gezählt. Er wurde der Schutzheilige des Feuers, weil Feuer an Bord auf den Holzschiffen sehr gefürchtet war. Wenn die Seeleute ihre Segel wie bei einem Feuer glühen sahen - elektrische Ladungen, die sich bei schweren Gewittern an Schiffsmasten entladen -, sahen sie darin St. Elmos Geist und glaubten sich geschützt durch ihn, ein gutes Omen. So benannten sie dieses Phänomen nach ihm, weshalb es noch heute Elmsfeuer genannt wird. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Eugen I., Papst

Wikipedia hat geschrieben:Der hl. Eugen I. (Geburtsdatum unbekannt; † 2. Juni 657) wurde am 10. August 654 als Nachfolger von Martin I. zum Papst gewählt, obwohl sein Vorgänger noch lebte.
Anlass der Wahl Eugens war wohl die Annahme, er könnte zu einer Versöhnung mit Byzanz unter Kaiser Konstans II., der maßgeblich für die Absetzung Papst Martins verantwortlich gewesen war, und Patriarch Petros beitragen. Insbesondere im Streit um den Monotheletismus wurde vermutet, dass Eugen eine versöhnliche Haltung einnehmen werde. Als es letztlich zu keiner Aussöhnung kam, drohte auch Eugen die gewaltsame Absetzung durch den byzantinischen Kaiser. Er verstarb jedoch, ohne dass es zu einer Eskalation gekommen wäre. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Odo (der Gute) von Canterbury, Bischof
Wikipedia hat geschrieben:Odo von Canterbury (* um 880 in Dänemark; † 2. Juni 959 in Canterbury) war ein englischer Erzbischof und ist ein Heiliger. Er wird auch als Odo der Gute bezeichnet.
Im 9. und 10. Jahrhundert waren auf der britischen Insel Bestrebungen im Gange, heidnische Stämme und Gruppierungen zu christianisieren.
Odo kam an den Hof des angelsächsischen Königs Alfred der Große, wo er christlich erzogen, getauft und auf den Priesterberuf vorbereitet wurde. 925 war er Bischof von Ramsbury. Odo und Erzbischof Wulfstan von York vermittelten 939 bei Leicester einen Friedensvertrag zwischen König Edmund I. von England und Olaf Guthfrithsson, dem Wikingerkönig von Jorvik.
942 übernahm er das Amt des Erzbischofs von Canterbury. Das dortige Domkapitel war ihm gegenüber sehr reserviert. Diesen anfänglichen Widerstand überwand Odo dadurch, dass er in der französischen Abtei Fleury die Ordensprofess der Benediktiner, ein feierliches Gelübde, ablegte.
Odo förderte in der Folgezeit das Mönchtum, die Seelsorge und kümmerte sich um die Reinheit der Sitten. Wegen seiner Güte und Hilfsbereitschaft erhielt er schon zu Lebzeiten den Beinamen der Gute.
Er war Erzieher seines Neffen, des nachmals heiliggesprochenen Oswald von York. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Photinus (Pothinos), erster Bischof von Lyon, Märtyrer
Wikipedia hat geschrieben:Pothinus (auch: Photinus) (* um 87; † 177 in Lyon) war Bischof von Lyon, Märtyrer und Heiliger.
Pothinus stammte wahrscheinlich, wie Irenäus von Lyon, aus Kleinasien, wo er noch den Apostel Johannes erlebt haben dürfte. Ebenso wie die christlichen Gemeinden in Vienne und Marseille bestand auch die Gemeinde in Lyon, deren erster überlieferter Vorsteher Pothinus um die Mitte des 2. Jahrhunderts wurde, aus Christen griechischer bzw. kleinasiatischer Herkunft. Unter Mark Aurel blieben die Christen im Römischen Reich von Verfolgung weitgehend verschont, da die Maxime galt, dass Christen nicht aufgespürt oder anonym denunziert werden durften; lediglich bei Verweigerung des Kaiserkultes drohte Bestrafung. Während es keine reichsweite Verfolgung gab, kam es aber dennoch lokal immer wieder zu Übergriffen gegen Christen. In Lugdunum (dem heutigen Lyon) wurden die Maßnahmen gegen die Christen schrittweise gesteigert. Zunächst wurde ihnen der Zutritt zu ihren Kirchen, zum Forum und den Thermen verwehrt. Dann durften sie sich überhaupt nicht mehr öffentlich zeigen. Als schließlich die Bevölkerung der Stadt zu Ausschreitungen gegen die Christen überging, beschloss der Statthalter in Lyon, den Christen den Prozess zu machen und verurteilte sie zum Tode. Details zu dieser Verfolgung und dem Martyrium der verurteilten Christen sind in einem Brief überliefert, der von den Gemeinden in Lyon und Vienne an die Schwestergemeinden in Asien geschrieben wurde - ihr Verfasser war möglicherweise Irenäus von Lyon. Der Bericht wurde von Eusebius von Caesarea in sein Werk mit aufgenommen. Danach war Pothinus im Jahr 177 bereits 90 Jahre alt, als er, wie auch einige seiner Leidensgenossen, an den zugefügten Misshandlungen im Kerker starb. Die übrigen Christen erlitten im Amphitheater der Stadt, dem Amphithéâtre des Trois Gaules, das Martyrium. Die Zahl der Märtyrer ist nicht genau bekannt; eine Überlieferung spricht von 48 Märtyrern, doch waren es vermutlich mehr. Am bekanntesten ist die Heilige Blandina. Daneben werden folgende Namen genannt: Vettius Egapethus, Zacharias, Macarius, Asclibiades, Silvius, Primus, Alpius, Vitalis, Comminus, October, Philomenus, Geminus, Julia, Albina, Rogata, Aemilia, Potamia, Pompeja, Rodone, Biblides, Quarta, Materna, sowie Helpis und Amnas (die beiden letzten sind möglicherweise dieselbe Person). Den wilden Tieren seien neben Blandina auch Alexander und Ponticus zum Fraß vorgeworfen worfen. Im Gefängnis seien gestorben: Aristäus, Fotinus, Cornelius, Zosimus, Titus, Zoticus, Julius, Apollonius, Geminianus, Julia und Ausona. Dazu kommen: Maturus, Sanctus, der Diakon und Attalus. Gregor von Tours nennt außerdem: Aemilia, Gamnite, Alumna und Mamilia, bei Ado und Notker sind außerdem Jameica, Pompeja und Domna aufgeführt.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
02. Juni: Hl. Blandina von Lyon, Märtyrerin

Wikipedia hat geschrieben:Blandina (* um 150; † um 177 in Lyon) ist eine frühchristliche Märtyrin und Heilige. [...]
Während der Herrschaftszeit des Kaisers Marc Aurel erlitt Blandina, die Sklavin einer christlichen Familie war, in Lyon das Martyrium. Eusebius von Caesarea berichtet, dass die Jungfrau Blandina unter der Folter standhaft blieb und daher schließlich unter anderem in einem Netz wilden Stieren vorgeworfen wurde. Diese rührten sie aber nicht an. Nach weiteren schweren Mißhandlungen - sie wurde auf einen glühenden Rost geworfen, gegeißelt, in ein Netz gebunden und einem wilden Stier vorgeworfen - wurde Blandina, nachdem sie die Marterungen aller ihrer Mitgefangenen hatte mitansehen müssen, schließlich erdolcht.
Blandina wird als Stadtpatronin von Lyon verehrt. Außerdem gilt sie als Patronin der Dienstmägde, Dienstboten und der Jungfrauen. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
03. Juni: Hl. Chlothilde

Wikipedia hat geschrieben:Chrodechild (auch Chrodichild, Chrodechilde, lat. Chrodigildis; die Namensformen Chlothilde, Clothilde, Klothilde, unter denen sie in der spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Literatur rezipiert wird, sind nicht authentisch) (* um 474 in Lyon; † 3. Juni 544 in Tours) war die zweite Frau von Chlodwig I. und durch diese Ehe Königin der Franken. Als Heilige Clothilde bzw. Chlothilde wird sie von der Kirche verehrt.
Sie wurde als Tochter von Chilperich II., Teilkönig der Burgunden in Vienne, und seiner Frau Caratene geboren und starb im Kloster Saint-Martin de Tours. Sie war eine Nichte der Burgunderkönige Gundobad und Godegisel.
Nachdem ihre Eltern 493 bei Rivalitäten um die Macht in Burgund von Gundobad ermordet worden waren, wurden sie und ihre Schwester durch ihren Onkel Godegisel an dessen Hof in Genf erzogen.
Chrodechild heiratete den merowingischen Frankenkönig Chlodwig I. zwischen 492 und 494 unter der Bedingung, dass sie ihre christliche Religion weiter ausüben durfte. Sie bekannte sich zum Katholizismus und trug zur Entscheidung Chlodwigs bei, ebenfalls diese Form des Christentums und nicht den bei anderen Germanenvölkern verbreiteten Arianismus anzunehmen.
Ihre Kinder wurden alle – die beiden älteren Söhne Ingomer und Chlodomer bereits vor ihrem Vater – getauft. Als jedoch Ingomer früh verstarb und Chlodomer schwer erkrankte, gab Chlodwig der Religion seiner Frau daran die Schuld. Erst als der zweite Sohn wieder gesundete und als Chlodwig bei einer großen Schlacht gegen die Alemannen den christlichen Gott um Hilfe anflehte und die Schlacht gewann, konvertierte er – und damit sein Reich – zum katholischen Christentum.
Zum Weihnachtsfest 497, 498 oder 499 ließ sich Chlodwig mit 3.000 anderen Franken vom Bischof Remigius von Reims taufen. Wegen ihres Beitrags zu diesem Entschluss wurde Chrodechild kirchlicherseits als Wegbereiterin für den katholischen Glauben in Europa betrachtet.
Aus der Ehe mit Chlodwig hatte sie vier Söhne und eine Tochter:
Ingomer, * etwa 493 oder 494, † sehr jung
Chlodomer, von 511 bis 524 König in Orléans
Childebert I., von 511 bis 558 König in Paris
Chlothar I., von 511 bis 561 König in Soissons, später König der Franken
Chlodechild, † 531, begraben in der Apostelkirche in Paris; sie heiratete 526 oder 527 den Westgotenkönig Amalrich
Nach dem Tod ihres Sohnes Chlodomer auf einem Feldzug gegen die Burgunden im Jahr 524 übernahm Chrodechild den Schutz seiner drei minderjährigen Söhne, ihrer Enkel Theudoald, Gunthar und Chlodoald (Chlodowald), um deren Erbrecht im Reich des verstorbenen Königs zu sichern. Dies scheiterte aber am Widerstand Childeberts I. und Chlothars I., die das Reich Chlodomers aufteilen und die Erbansprüche ihrer unmündigen Neffen ausschalten wollten. Wie der Geschichtsschreiber Gregor von Tours berichtet, brachten Chlothar und Childebert mit einer List die Kinder in ihre Gewalt und ließen dann Chrodechild fragen, ob die Kinder geschoren und damit herrschaftsunfähig gemacht oder getötet werden sollten. Chrodechild antwortete, sie wolle die Kinder lieber tot als herrschaftsunfähig sehen. Darauf tötete Chlothar den zehnjährigen Theudoald und den siebenjährigen Gunthar eigenhändig; Chlodoald wurde unter nicht näher bezeichneten Umständen vor seinem Onkel gerettet und überlebte durch Eintritt in den geistlichen Stand.
Nach dem Tode Chlodwigs 511 gründete Chrodechild Klöster und stiftete Kirchen. Sie wurde – wie ihr Mann und ihre Tochter – in der Apostelkirche in Paris, der späteren Kirche Sainte-Geneviève bestattet.
Als Heilige Clothilde wird sie als Patronin der Frauen und Notare verehrt. Sie wird oft mit einem Kirchenmodell und einem Buch, den Armen spendend, dargestellt. Ihr Fest ist der 3. Juni.

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
03. Juni: Hl. Karl Lwanga und Gefährten, Märtyrer

Wikipedia hat geschrieben:Karl Lwanga (* 1865 in Bulimu in Uganda; † 3. Juni 1886 in Namugongo) war ein ugandischer Märtyrer. [...]
Nachdem unter König (Kabaka) Mutesa I. christliche Missionare in Uganda ihre Arbeit aufgenommen hatten, waren diese unter dem König Mwanga II. wieder Repressionen ausgesetzt. Inzwischen war ein Teil der Bevölkerung Christen geworden bzw. bereitete sich als Katechumenen auf die Taufe vor. Besonders unter den Pagen am Hofe des Königs gab es viele Christen. Karl Lwanga war der Anführer der königlichen Pagen und war im Juni 1885 getauft worden. Nach der Ermordung des Pagen Denis Ssebuggwawo, eines Katecheten, ließ König Mwanga erklären, dass alle Angehörigen des Hofes, die nicht vom Beten abließen, getötet werden sollten und ließ am 27. Mai 1886 eine Gerichtssitzung anberaumen. Er erklärte: „Diejenigen von Euch, die nicht beten, sollen an meiner Seite bleiben; die anderen sollen sich gegenüber an der Schilfwand aufstellen“. Karl Lwanga und 15 weitere Pagen gingen zur Wand hinüber. Zwei von ihnen ließ der König kurz darauf zerstückeln und als Götzenopfer darbringen, während man die anderen nach Namugongo brachte, wo sie in Strohbündel gebunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
Insgesamt wurden in der Verfolgung unter Kabaka Mwanga II. weit über 100 Christen getötet. In Namugongo starben 32 Katholiken und Anglikaner auf dem Scheiterhaufen, manche von ihnen wurden vorher gefoltert.
Papst Benedikt XV. sprach Karl Lwanga und seine Gefährten 1920 selig. Papst Paul VI. sprach am 18. Oktober 1964, während des Zweiten Vatikanischen Konzils, 22 Märtyrer dieser Verfolgung heilig, darunter Karl Lwanga und seine Gefährten.
Karl Lwanga wurde von Papst Pius XI. 1934 zum Patron der Jugend Afrikas erklärt. [...]

Gott, du lässt das Blut der Märtyrer zum Samen werden für neue Christen. Erhöre unser Gebet für die Kirche in Afrika. Lass den Acker, der vom Blut des heiligen Karl Lwanga und seiner Freunde getränkt ist, reiche Ernte tragen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
03. Juni: Hl. Kevin von Wicklow, Bischof, Abt, Klostergründer

Wikipedia hat geschrieben:Kevin von Glendalough oder auch Kevin von Wicklow bzw. Kevin von den Engeln, altirisch Cóemgen, irisch Caoimhghin, (* angeblich um 498 in der Nähe von Dublin; † 3. Juni 618 in Glendalough) ist ein irischer Heiliger des 6. und 7. Jahrhunderts. Er ist der Patron der irischen Hauptstadt Dublin und der gleichnamigen Erzdiözese. [...]
Kevin stammte aus königlichem Geschlecht. Angeblich wirkte er schon früh Wunder und bereits vor seiner Geburt wurde seinen Eltern von einem Engel verkündet, dass ihr Sohn „Vater vieler Mönche“ sein werde, weswegen sie ihn zur religiösen Ausbildung ins Kloster Kilnamanagh bei Dublin schickten. Nach einer Wallfahrt nach Rom zog er sich nach Glendalough im County Wicklow zurück. Dort fand er schnell Anhänger und gründete um 549 am oberen der beiden Seen von Glendalough die Abtei, der er bis zu seinem Tod als Abt vorstand. Dort unterwies er viele Menschen im asketischen Leben. Er selbst lebte meist zurückgezogen im Wald und am Ufer des Sees; die Fundamente seiner „Zelle“ im Wald (Saint Kevin's Cell) und die Höhle, in der er angeblich schlief (Saint Kevin's Bed) sind bis heute erhalten. Unklar ist, ob er auch Bischof war. Jedenfalls waren die nachfolgenden Äbte seiner Abtei immer auch gleichzeitig Bischof der Diözese Glendalough, die die heutige Diözese Dublin abdeckte, welche sich damals nur auf das Stadtgebiet Dublins beschränkte. Die Diözese Glendalough bestand bis Anfang des 13. Jahrhunderts.
Die Abtei entwickelte sich nach Kevins Tod schnell zu einem Mittelpunkt des christlichen Lebens und nahe dem unteren See entwickelte sich die große Klosterstadt mit einem typisch irischen Rundturm, der Kathedrale und der Sankt Kevins Kirche. Die meisten der heute noch zu besichtigenden Ruinen in Glendalough stammen wahrscheinlich aus dem 10. bis 12. Jahrhundert und wurden an den Stellen gebaut, an denen schon in Kevins Zeit bzw. in den Jahren nach seinem Tod einfachere Gebäude aus Holz und anderen Materialien standen. Sie wurden im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit verbliebenem Original-Baumaterial rekonstruiert.
Kevin ist auch Patron der Amseln, mit denen er häufig dargestellt wird, da er sich ein Leben im Einklang mit der Natur wünschte und daher angeblich oft von Vögeln begleitet wurde. Das Patronat der Amseln beruht auf der Erzählung, dass eine Amsel in der Fastenzeit, als Kevin mit ausgebreiteten Armen betete, ein Ei in seine Hand gelegt haben soll. Kevin sei dann in der Gebetshaltung geblieben, bis das Ei ausgebrütet war und das Junge davonfliegen konnte. Er soll sich unter Tieren wohler gefühlt haben als unter Menschen, und es gibt zahlreiche Erzählungen über seinen Umgang mit Tieren.
Kevin starb um 618 angeblich im biblischen Alter von 120 Jahren. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
03. Juni: Hl. Morandus, Priester, Mönch
Wikipedia hat geschrieben:Morandus (* um 1075 bei Worms; † 3. Juni 1115 bei Altkirch im Elsass) war ein Mönch und gilt als „Apostel des Sundgaus“. Er ist ein Heiliger der katholischen Kirche und als solcher ein Patron des Hauses Habsburg, der Winzer, des Weins und wird gegen Besessenheit angerufen.
Gemäß der Überlieferung wurde Morandus im Wormsgau geboren, war Zögling der bischöflichen Schule des Bistums Worms und erhielt in der Bischofsstadt wahrscheinlich schon die Priesterweihe. Auf der Rückreise von einer Wallfahrt nach Santiago de Compostela trat er in die Abtei Cluny als Benediktinermönch ein. Von Abt Hugo dem Großen wurde er zunächst in ein Kloster der Auvergne entsandt. Etwa im Jahre 1106 berief man ihn nach Altkirch ins Filialkloster St. Christoph, welches Friedrich Graf von Pfirt im oberen Elsaß nahe Basel gestiftet hatte.
Bei dem Dorf Altkirch existierte eine uralte, dem Hl. Christoph geweihte Kirche, von welcher man behauptete, sie stamme aus der Zeit, zu der das Christentum hier eingeführt worden war. Man nannte sie deshalb „alte Kirch“, wovon sich auch der Namen des Ortes herleitet. Der ortsansässige Graf Friedrich I. von Pfirt - Urgroßneffe des Heiligen Leo IX. - vergrößerte jene alte Kirche, stiftete dort ein Benediktinerkloster und erbat sich vom Hl. Hugo von Cluny eine Anzahl Ordensleute. Die Schenkungsurkunde für das neue Kloster hat Graf Friedrich I. von Pfirt am 3. Juli 1105 unterzeichnet und in den ersten Wochen des Jahres 1106 erfolgte die Bestätigung durch Papst Paschalis II.
Der erste Prior, Constantius, erkannte sofort, dass hier im Elsaß mindestens ein deutsch sprechender Mönch notwendig sei, weshalb man den deutschen Mitbruder Morandus kommen ließ. Infolge seines Seelsorgeeifers stieg Morandus bald selbst zum Prior auf; die Frömmigkeit und Barmherzigkeit des Priesters waren weithin berühmt. In einer alten Lebensbeschreibung heißt es darüber:
„Man sah ihn zu jeder Jahreszeit, ob es auch regnete und schneite, mit unbedecktem Haupte dahinwandern, ein Buch in der einen Hand, den Pilgerstab in der andern. Durch seine bald strengen, bald liebevollen Worte wurden die härtesten Herzen erweicht, die boshaftesten Sünder bekehrt. Auch große und vornehme Herren ließen sich von ihm zu Gott zurückführen. Unzählig aber war die Menge der Kranken, Notleidenden und Unglücklichen, die aus allen Gegenden herkamen und bei ihm Trost und Hilfe fanden.“
– J. E. Stadler, F. J. Heim und J. N. Ginal: „Vollständiges Heiligen-Lexikon“, Band 4, Mainz 1869
Morandus wurde förmlich der Seelsorger des gesamten Landstriches, weshalb man ihn bis heute „Apostel des Sundgaus“ nennt. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
04. Juni: Hl. Filippo Smaldone, Priester, Ordensgründer

Wikipedia hat geschrieben:Filippo Smaldone (* 27. Juli 1848 in Neapel, Italien; † 4. Juni 1923 in Lecce, Italien), katholischer Priester, Gründer der „Salesianerinnen vom Heiligsten Herzen“. Smaldone widmete sich gehörlosen Kindern. Er ist neben Franz von Sales der zweite Schutzpatron für Gehörlose.
Am 15. Oktober 2006 wurde er von Papst Benedikt XVI. heiliggesprochen.
Filippo Smaldone wurde 1848 in Neapel, Italien, geboren. Schon sehr früh entschied er sich Priester zu werden, so dass er in das Priesterseminar von Neapel eintrat. Während der Zeit seines Studiums kam er in Kontakt mit der großen Zahl an Gehörlosen, die es damals in Neapel gab und für die sich niemand besonders kümmerte. Die Hilfe für die Gehörlosen, die er als Student begann, wird sein ganzes Leben beeinflussen.
Am 23. September 1871 wurde er zum Priester geweiht. In den ersten Priesterjahren hielt er neben seinen Bemühungen um die Gehörlosen der Stadt auch Katechismusunterricht und besuchte die Kranken. Dies tat er auch, als in Neapel eine Pockenepidemie ausbrach. Durch seine Krankenbesuche wurde er angesteckt und wäre selbst fast gestorben. Als er sich freiwillig für die Mission melden wollte, konnte ihn sein Beichtvater überzeugen, dass seine wahre Mission nicht in fernen Ländern, sondern bei den Gehörlosen von Neapel sei. Danach widmete er sich voll und ganz dieser Arbeit und engagierte dafür auch weitere Priester und Laien. Vor allem entwickelte er eine eigene Gebärdensprache, um sich mit den Gehörlosen besser verständigen zu können.
m März 1885 zog Smaldone nach Lecce. Dort gründete er am 25. März 1885 zusammen mit dem Priester Lorenzo Apicelia und einer Gruppe von Frauen seine erste Einrichtung für Gehörlose. Aus dieser Einrichtung entstand die Kongregation der „Salesianerinnen vom Heiligsten Herzen“. Smaldone wählte den Namen „Salesianerinnen“, weil er seine Ordensgemeinschaft, die sich vor allem um die Gehörlosen kümmern soll, unter den besonderen Schutz des heiligen Franz von Sales, dem Patron der Gehörlosen, stellen wollte. Die Salesianerinnen vom Heiligsten Herzen fassten sehr schnell Fuß und blühten auf. Schon wenige Jahre später konnte Smaldone ein weiteres Haus in Bari gründen. Bis heute ist die Hauptaufgabe der Ordensgemeinschaft die Erziehung gehörloser Kinder, sie widmen sich allerdings auch anderen behinderten Kindern, Waisenkindern und Kindern, die von ihren Eltern verlassen wurden. Die spirituelle Basis der Ordensgemeinschaft bildet die salesianische Spiritualität, so dass sie zur salesianischen Familie gezählt werden.
Neben seiner Tätigkeit für Gehörlose war Filippo Smaldone auch Beichtvater und Geistliche Begleiter für Priester, Seminaristen und verschiedene religiöse Gemeinschaften, unter anderem für die Missionare des hl. Franz von Sales. Er gründete auch noch eine weitere religiöse Gemeinschaft, die so genannte „Eucharistische Liga der Anbetungspriester und Anbetungsfrauen“. Er wurde außerdem zum Domherrn der Kathedrale von Lecce ernannt und erhielt von der Stadt Lecce eine Aufzeichnung für seiner Verdienste um die Gehörlosen. Er starb am 4. Juni 1923 in Lecce im Alter von 75 Jahren auf Grund einer schweren Diabetes und Herzschwäche. [...]

- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
04. Juni: Hl. Franz Caracciolo, Priester, Ordensgründer

Wikipedia hat geschrieben:Francesco Carácciolo (* 13. Oktober 1563 in Villa Santa Maria in den Abruzzen, Italien; † 4. Juni 1608 in Argenta) ist Mitbegründer eines christlichen Männerordens und wurde von der römisch-katholischen Kirche heiliggesprochen.
Francesco Carácciolo entstammte einer neapolitanischen Adelsfamilie. Er erholte sich auf wundersame Weise von einer schweren Hautkrankheit und verschenkte daraufhin seine gesamten Besitztümer. Er studierte Katholische Theologie und empfing im Jahr 1587 das Sakrament der Priesterweihe. Es schloss sich einer Priestergemeinschaft an, die sich um die geistliche Betreuung von Galeerensklaven und zum Tode verurteilten Menschen bemühte. In der Zeit der Gegenreformation gründete er 1588 gemeinsam mit anderen den Orden der Minderen Regularkleriker, um die anstehenden Aufgaben durch die strukturelle Ordnung einer Kongregation besser koordinieren zu können. Noch im gleichen Jahr bestätigte Papst Sixtus V. die Gemeinschaft. Erster General des Ordens wurde 1588 Agostino Adorno, zweiter General wurde 1593 Franz von Carácciolo.
Francesco Carácciolo unternahm zahlreiche Pastoralreisen auf die Iberische Halbinsel und sorgte dadurch für eine kontinuierliche Ausbreitung seines Ordens. Er starb am 4. Juni 1608 in Argenta und wurde in Neapel bestattet. Papst Pius VII. sprach ihn am 24. Mai 1807 heilig. Franz von Carácciolo wird als Schutzpatron von Neapel verehrt. [...]

Deus, qui beátum Francíscum, novi órdinis institutórem, orándi stúdio et poeniténtiæ amóre decorásti: da fámulis tuis in eius imitatióne ita profícere; ut, semper orántes et corpus in servitútem redigéntes, ad coeléstem glóriam perveníre mereántur.
Per Dominum.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
04. Juni: Hl. Quirinus von Siscia, Bischof, Märtyrer
Wikipedia hat geschrieben:Quirinus von Siscia († 4. Juni 308 oder 309 in Sabaria - heute: Szombathely, Ungarn) ist ein Heiliger der katholischen Kirche. Quirinus (kroat. Sveti Kvirin Sisački) war frühchristlicher Bischof von Siscia in Pannonia (heute Sisak, Kroatien) gemäß den Aufzeichnungen des Eusebius von Caesarea. [...]
Einem Martyriumsbericht zufolge (Passio) wurde Quirinus in der Spätzeit der diokletianischen Christenverfolgung unter Galerius im Jahre 309 arrestiert. Nach einem erfolgreichen Fluchtversuch wurde er in den Kerker geworfen, wo es ihm gelang, den Kerkermeister Marcellus zum Christentum zu bekehren. Nach drei Tagen wurde er auf Befehl des Amantius, Statthalter der Provinz Pannonia Prima, nach Sabaria gebracht. Da er seinem Glauben nicht abschwor und den Kaiserkult verweigerte, wurde er wohl gefoltert und schließlich mit einem Mühlstein am Hals in dem Fluss Sibaris (heute: Gyöngyös bzw. dessen Nebenfluss Perint) ertränkt. Christen aus Sabaria bargen seinen Leichnam und begruben ihn außerhalb der Stadtmauern nahe dem Stadttor nach Ödenburg (Porta Scarabantea) Später wurde der geborgene Leichnam in der Basilika von Sabaria beigesetzt.
Nach einer anderen Legende ertrank er nur beinahe, da es ihm gelang sich von der Last zu befreien. Er konnte daraufhin entkommen und wirkte weiter als Prediger und Missionar. Der Heilige Florian, ein anderer Heiliger Pannoniens, soll auf ähnliche Weise den Martertod erlitten haben. [...]
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -
Re: Heilige des Tages
05. Juni: Hl. Bonifatius, Bischof, Glaubensbote in Deutschland, Märtyrer

Wikipedia hat geschrieben:Bonifatius, Wynfreth (auch Wynfnith, Winfrid, Winfried, * 672/673, spätestens 675 in Crediton in der Nähe von Exeter im damaligen Kleinkönigtum Wessex, der heutigen Grafschaft Devon, im Südwesten Englands; † 5. Juni 754 oder 755 bei Dokkum in Friesland), war einer der bekanntesten Missionare und der wichtigste Kirchenreformer im Frankenreich. Er war Missionserzbischof, päpstlicher Legat für Germanien, Bischof von Mainz und zuletzt Bischof von Utrecht und Gründer mehrerer Klöster, darunter Fulda. Seit der Reformation wird er von der katholischen Kirche als „Apostel der Deutschen“ bezeichnet. [...]

Herr, unser Gott, erhöre die Bitten deiner Gemeinde, die heute das Fest des heiligen Bonifatius feiert. Auf seine Fürsprache schenke uns deine Hilfe, damit wir den Glauben treu bewahren, den er unseren Vätern gepredigt und mit seinem Blut besiegelt hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Deus, qui multitúdinem populórum, beáti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis zelo, ad agnitiónem tui nóminis vocáre dignátus es: concéde propítius; ut, cuius sollémnia cólimus, étiam patrocínia sentiámus.
Per Dominum.
- Nutzer nicht regelmäßig aktiv. -